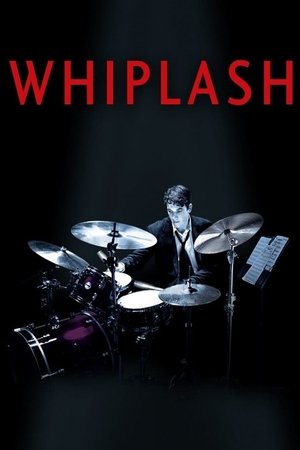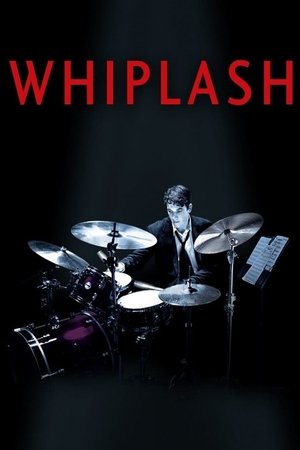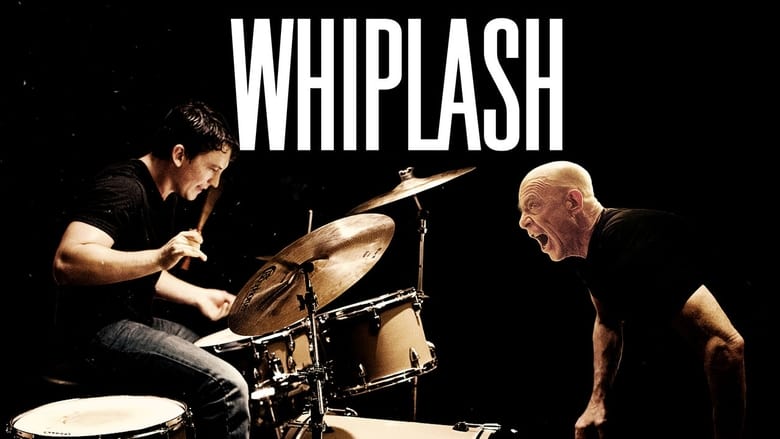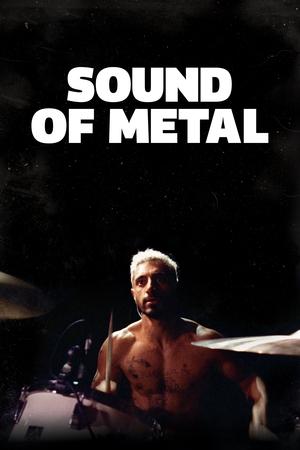Wir alle hatten diesen einen Lehrer in unserer Schulzeit: Ein Klassenzimmer voller pubertierender, ungestümer Jugendlicher mutierte binnen Sekunden zu einer mucksmäuschenstillen Vorzeigeklasse eines Militärinternats sobald er den Raum betrat. Während man hinter seinem Rücken ihn mit unendlichem Hass bewarf, verkam man ihm gegenüber zu einer verängstigten, stotternden Karikatur. „Whiplash“ belebt diese Figur, die jeder einzelne Zuschauer mit der ein oder anderen Person aus dem privaten Leben gleichsetzen kann, on Screen zum Leben. Und genau diese unbequeme Vertrautheit des Publikums nutzt Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle aus und bildet dadurch das Fundament der starken Effektivität seiner 107-minütigen Folter-Nummer.
Von der ersten Minute an gehört der Film J.K. Simmons. Was der Hollywood-Veteran in „Whiplash“ von der Leine lässt (pun intended), ist schlichtweg unbeschreiblich und er katapultiert sich mit einem Schlag auf ein Level mit R. Lee Ermeys Sgt. Hartman aus Kubricks „Full Metal Jacket“. Es wäre sogar legitim, zu argumentieren, dass Simmons die legendäre Rolle des Drill-Instructors hinter sich läst, da er im Gegensatz zu Sgt. „Runter von meinem Kletterturm“ Hartman die Bedrohung oft durch seine alleinige Präsens und Mimik ausstrahlt und nicht andauernd bellend umher läuft.
Trotz seiner autoritären Position als unumstrittener Patriarch in jeglicher Situation, bleibt der Musik-Lehrer Fletcher glücklicherweise nicht nur eine angsteinflößend-laute Abziehfigur. Viel mehr wird Fletcher von seiner nicht endenden Liebe für den Jazz angetrieben. Er ist fest entschlossen seine Schüler bis an ihr Limit zu treiben und ohne mit der Wimper zu zucken auch darüber hinaus. Die meisten brechen unter dem Druck, den Fletcher auf alle ausübt, psychisch zusammen und verlassen seinen Kurs. Fletcher ist auf der Suche nach einem musikalischen Rohdiamanten und testet jeden Stein, der ihm unterkommt, wobei er lieber jeden einzelnen vielversprechenden Stein zerbricht, als im Ungewissen darüber zu sein, ob sein Stein auch wirklich ein Diamant ist oder nicht. Für Fletcher ist es absolute Perfektion oder nichts. Dass er dabei jungen Menschen die Liebe zur Musik quasi aus dem Leib prügelt ist der Preis, den er bezahlt, für das eine musikalische Genie, den er möglicherweise eines Tages hervorbringt.
"There are no two words in the english language more harmful than 'Good Job'."
Das junge Musiktalent ist in diesem Fall Andrew. In der Charakterzeichnung weiß Andrew deshalb zu gefallen, weil er im Laufe des Films schon so ein bisschen zu einem Arschloch mutiert und somit die Botschaft von „Whiplash“ unterstreicht: Um wahre Größe zu erreichen, erfolgreich und der Beste zu sein, kann man sich von nichts und niemandem aufhalten lassen. Dieses Lebensmotto, dem sich Andrew mit seinen zarten 19 Jahren im Laufe der Geschichte immer mehr verschreibt, hat gravierende Auswirkungen auf seine Persönlichkeit. Anfangs noch offenbar freundlich, scheut er später nicht davor zurück sich Feinde zu machen. Er verlässt seine Freundin, indem er ihr wortwörtlich ins Gesicht zischt, dass er sich auf seinem Weg nach oben nicht mit einer „durchschnittlichen“ Person belasten darf. Diese Arroganz, Ignoranz und jugendliche Naivität Andrews sind Hürden in der Handlung, die den jungen Jazz-Schlagzeuger zum Stolpern bringen, nachdem er sich in seinem Tunnelblick und Gier nach Perfektion (und auch Fletchers Anerkennung) alle gegen sich aufbringt und schließlich besiegt alleine da liegt. Im Großen und Ganzen ist Andrew teilweise ein unsympathischer Mistkerl und somit nicht der typische Underdog, der das Herz der Zuschauer mit Charme gewinnen soll. Dass er das Publikum dennoch auf seine Seite zieht, ist Resultat des Identifikationspotenzials des Zuschauers mit Andrew und dem Folter-Lehrer, fantastischen Dialogen und der tollen Darstellung von Miles Teller. Trotz seiner 28 Jahre nimmt man ihm die Performance eines 19 jährigen Studenten sofort ab, wobei er es nicht immer schafft mit J.K. Simmons Schritt zu halten.
Dass Andrews Weltansicht und Verständnis von Erfolg jedoch nicht ganz korrekt sind, beweist Chazelle mit der Figur von Andrews Vater. Ganz im Gegenteil zu Andrews Meinung, er könne die Leiter zum Erfolg ausschließlich alleine erklimmen, zeigt sein Vater, dass es nötig ist, Menschen bei sich zu haben, die einen auffangen können, sollte man mal ausrutschen, indem er ihn mit offenen Armen empfängt nachdem Andrew versagt. All diese kitschigen Lebensweisheiten sind jedoch sehr subtil in die Handlung eingebaut und werden nie explizit im Dialog angesprochen, sondern ausschließlich durch Handlungen und Handlungsschritte der Charaktere erzählt. Ganz starkes Screenwriting.
Besonders wert gelegt wird in „Whiplash“ auf einen zur Geschichte passenden Jazz-Score, wobei das leise Schlagzeug im Hintergrund immer perfekt die oft viel zu intensive Atmosphäre gut zu unterstreichen weiß.
Ganz fehlerfrei ist „Whiplash“ dann jedoch leider doch nicht. Neben der sehr guten, aber neben J.K. Simmons „nicht gut genug"en Darstellung Miles Tellers, verliert der Plot in der zweiten Hälfte auch etwas an Intensität und Zugkraft. Ebenso ist Andrews Freundin, die nur in zwei kurzen Szenen auftaucht, lediglich ein Plotdevice um die Handlung zu lenken und kein wirklicher Charakter. Im Großen und Ganzen sind diese Ausrutscher jedoch Peanuts.
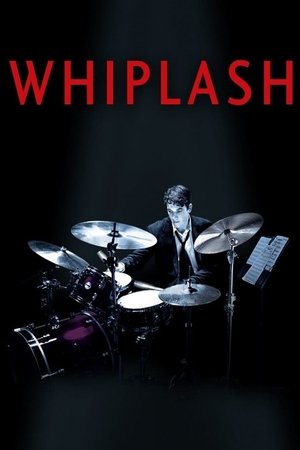 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org