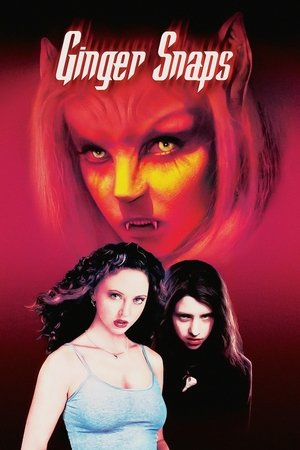Quelle: themoviedb.org
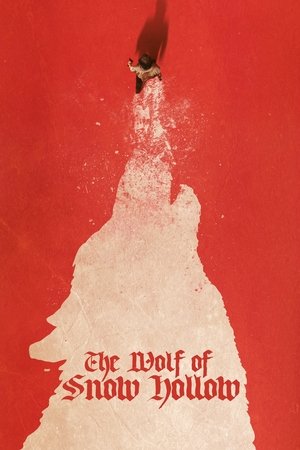 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org
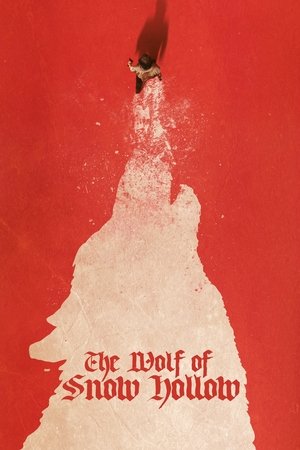
- 83 Min MysteryKomödieHorrorThriller
- Regie Jim Cummings
- Drehbuch Jim Cummings
- Cast Jim Cummings, Riki Lindhome, Robert Forster, Chloe East, Will Madden, Annie Hamilton, Jimmy Tatro, Hannah Elder, Kelsey Edwards, Skyler Bible, Anne Sward, Demetrius Daniels, Kevin Changaris, Chase Palmer, Daniel Fenton Anderson, Rachel Jane Day
Kritik
Fazit
Kritik: Jacko Kunze
Beliebteste Kritiken
-
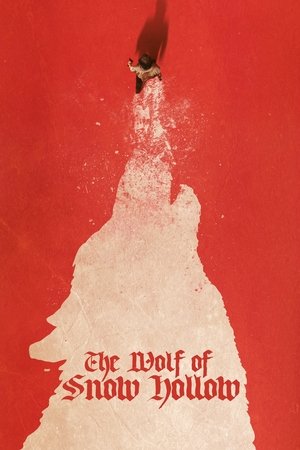
The Wolf of Snow Hollow
Die Bevölkerung der friedlichen Kleinstadt Snow Hollow sieht sich aus heiterem Himmel in einer Vollmondnacht mit einem bestalischen Mord konfrontiert. Das Bizarre daran ist nicht nur die aufs Übelste zugerichteten Leiche des Opfers, sondern der große Pfotenabdruck neben selbiger. John Marshall, seinerseits Polizist in dem Ör...
Moviebreak empfiehlt
Wird geladen...
×