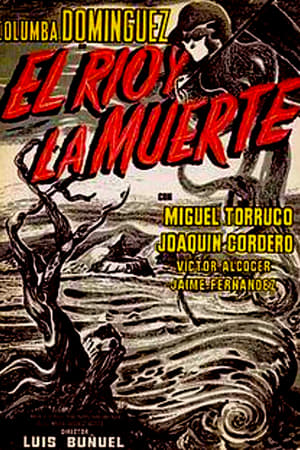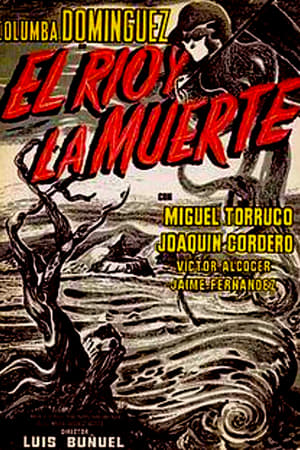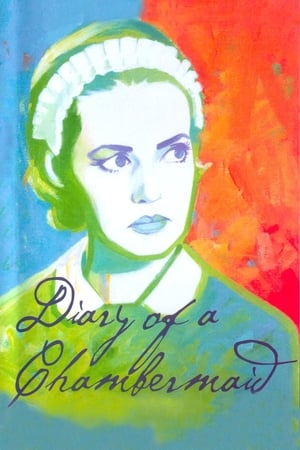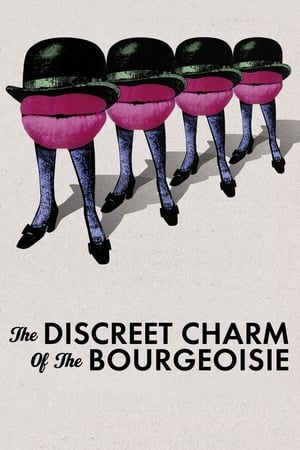Die korpulente Filmographie Luis Buñuels (Dieses obskure Objekt der Begierde) erweckte nie den Eindruck absoluter Geschlossenheit, wie es einem bei anderen Regisseuren dieses Kalibers erscheinen mag. Stattdessen begegnet man immer wieder den kleineren seiner Filme, die in der Mitte seines Schaffens, irgendwo zwischen dem breit rezipiertem Früh- und Spätwerk, untergegangen sind. Buñuel, der früh als verstörender Surrealist Aufsehen erregte, um sich später mit Filmen wie Belle de jour in bürgerlichen Kreisen einen Namen zu machen, hat eine Reihe von bemerkenswerten, doch kaum bekannten Filmen vorgelegt, die seinem Œuvre andere Facetten abgewinnen.
Der Fluss und der Tod skizziert einen archaisch anmutenden Brauch in einem mexikanischen Dorf. Über Generationen herrscht ein blutiges Hin-und-Her zwischen zwei verfeindeten Familien, das seine eigenen Regeln kennt. Jeder, der nach einer Tat gegen die jeweils andere Familie, einen ans Dorf grenzenden Fluss überquert, um nicht mehr zurückzukommen, wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Kehrt er jedoch zurück, wird der Freispruch aufgehoben, er muss wieder mit Rache rechnen. Die ungewöhnliche Verkrampfheit, die im Umgang mit dieser Regel herrscht, sowie die unfreiwilligen Lockerungen in den Dialogen und Zwischensequenzen, erwecken einen bisweilen humoresken Eindruck. Dieser grenzt keinesfalls an Albernheit, sondern ist dezent genug, um als Verwunderung verstanden zu werden, die uns die Distanz zu jenem gesellschaftlichen Brauch ins Bewusstsein ruft.
Buñuels Werk hat Western-Anleihen, die sich sowohl in den Motiven einer Welt des Misstrauens, der Konflikthaftigkeit und der Ehrenregeln jenseits der Gesetze zeigen. Aber auch die dichte Form, das wortkarge Pflichtbewusstsein einzelner Charaktere und Showdown-Momente untermalen diesen Eindruck. Angereichert wird diese Ästhetik mit dramatischen Zuspitzungen und leicht surreal anmutenden Momenten, in denen die Handschrift des Regisseurs wohl am Deutlichsten zu Tage tritt. Davon abgesehen ist Der Fluss und der Tod zurückhaltend inszeniert und im Gegensatz zu vielen anderen Werken des Großmeisters deutlicher daran interessiert, seine Handlung auszuerzählen. Nicht zuletzt wird das an Voice-Over-Szenen deutlich, die hin und wieder überleiten und erklären.
So ungewohnt vieles an diesem Film für Buñuel zu sein scheint, so einschlägig ist sein Sujet. Im Kern widmet er sich dem Thema der strukturell verhinderten Versöhnung, die in Abgrenzung zur Vergebung, die auf individueller Ebene stattfindet, eine politische, friedensversichernde Funktion hat. In einer Gesellschaft des Misstrauens, in der Gewalt nicht kommunikativ überwunden, sondern fest in ihre Abläufe eingeschrieben ist, scheint der Showdown unvermeidlich. Die letzten Überbliebenen, die sich am Ende gegenüberstehen, sollen den Endpunkt der Eskalation darstellen: eine Familie wird ein für alle Male fallen. Doch lässt Buñuel seine Charaktere ihr verselbstständigtes Politikum überwinden, lässt am Ende die Versöhnung einfallen.
Wenn die beiden Kontrahänten entgegen des Willens der Dorfanwohner die Waffen niederlegen und sich in die Arme fallen, versöhnen sie sich nicht nur, indem sie politische Antagonismen beilegen, sie vergeben auch einander, indem sie vergessen können, welches Blut an den Händen des jeweiligen Gegenübers klebt. Der Fluss und der Tod setzt der archaischen Feindseligkeit die Vorstellung eines humanistischen Liberalismus gegenüber, der die Akteure von Sippenhaft und familiärer Kultgefangenschaft befreit. Buñuel ist ein moderner, emanzipatorischer Film geglückt, der formell und inhaltlich das Schaffen des Großmeisters um eine beeindruckende Facette erweitert.