Die 70er war eine wichtige Dekade für den Horrorfilm, schaffte er es doch für kurze Zeit aus der B-Movie-Nische, in die er bis auf wenige Ausnahmen (Rosemaries Baby) in den letzten Jahrzehnten gedrängt wurde. Plötzlich interessierten sich auch die großen Studios wieder für das Genre, was sich auszahlen sollte. Warner Brothers gelang 1973 mit Der Exorzist ein Meilenstein, der für fast alle wichtigen Oscars nominiert wurde und zwei davon (einen sogar für das Drehbuch) einheimste. Drei Jahre später wurde Der Weiße Hai der erste buchstäbliche Blockbuster, ein kommerzieller Sechser im Lotto für Universal und sogar dreifacher Oscargewinner. Ein Jahr später war dann 20th Century Fox an der Reihe und feierte die Geburt des Antichrist mit Das Omen.
Eine nicht ganz einfache Geburt, denn trotz des Erfolges der Konkurrenz schien das gewünschte Personal immer noch skeptisch. Stars wie Charlton Heston (Planet der Affen), Roy Scheider (Atemlos vor Angst) oder William Holden (The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz) lehnten die Hauptrolle ab und auch der präferierte Regisseur Mike Hodges (Get Carter) hatte kein Interesse an dem Projekt. Aus Fehlern (und vor allem verpassten Erfolgen) scheint man tatsächlich zu lernen, beim zwei Jahre später entstandenen Sequel Omen II – Damien hieß der Hauptdarsteller William Holden und Mike Hodges übernahm ursprünglich die Regie, bis er nach wenigen Wochen aufgrund von „künstlerischen Differenzen“ ausstieg. Glück für den bis dahin überwiegend im TV beschäftigten Richard Donner (Lethal Weapon – Zwei stahlharte Profis), dem damit seinen Durchbruch als später sehr erfolgreicher Kinoregisseur gelang und Gregory Peck (Ein Köder für die Bestie), der mit einem deutlichen Karrieretief zu kämpfen hatte und dem Abwärtstrend mit diesem Film kurzzeitig entgegenwirken konnte.
Peck schlüpft in die Rolle des amerikanischen Botschafters Robert Thorn, dem am eigentlich glücklichsten Tag seines Lebens vom Schicksal (was sich rückwirkend betrachtet zu bezweifeln gilt) übel mitgespielt wird. Nur wenige Minuten nach der Geburt verstirbt sein Sohn. Noch bevor seine Frau die niederschmetternde Nachricht erhalten kann, bietet sich wie durch ein Wunder oder ein Geschenk des Himmels (auch das eher nicht) eine zweite Chance. Zeitgleich wurde ein Junge geboren, dessen Mutter verstarb und über keine Angehörigen verfügt. Unter der Hand wird ein geheimer Austausch durchgeführt, um das Familienglück doch noch auf den Weg zu bringen. Fünf unbeschwerte Jahre lang die offenbar richtige, wenn auch moralisch nicht astreine Entscheidung. Der kleine Damien ist der Sonnenschein des Paares, beruflich geht es steil bergauf, nicht könnte die perfekte Idylle scheinbar trüben. Bis Damien in sein sechstes Lebensjahr eintritt. Schon die Geburtstagsparty erlebt einen traumatischen Höhepunkt und bildet nur den Anfang für eine Häufung merkwürdiger Begebenheiten, die Thorns Gattin Katherine (Lee Remick, Der Schrecken der Medusa) an den Rande des Wahnsinns treiben und ihn nachforschen lässt, was zu einer erschreckenden Vermutung führt.
Mit seinem für damalige Verhältnisse soliden, aber auch nicht übermäßig üppigen 2,5 Millionen Dollar Gesamtbudget hebt sich Das Omen trotzdem sichtlich über den Standard des Horrorfilms dieser Tage ab. Auch natürlich wegen Weltstar Gregory Peck. Für das Genre war das hier (und ist es immer noch) ganz großes, hochwertig produziertes Kino, für das Jerry Goldsmith einen legendären (und Oscarp-rämierten) Score entwarf. Sein „Ave Satani“ geht unter die Haut, wie der Film allgemein, obwohl bzw. gerade weil er es gar nicht nötig hat, auf heute scheinbar als unvermeidlich geltende Methoden zurückzugreifen. Er verzichtet komplett auf Jump Scares, einen hohen Bodycount, Gore (die einzige Szene dieser Art ist heutzutage alles andere als waffenscheinpflichtig) und sogar große Überraschungen oder gar einen Twist. Er spielt (für den Zuschauer) ganz offensiv mit offenen Karten, was ihn noch viel bedrohlicher und unheimlicher macht. Wir kennen vermutlich die Wahrheit, doch wie schwer muss es für einen Ehemann, liebenden Vater und mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehenden, angehenden Politiker von Weltformat sein, dieser sich langsam offenbarenden, grausamen und so unfassbaren Realität zu stellen? Oder viel eher: Ihr in das vordergründig so unschuldige Gesicht zu blicken und trotzdem das zu tun, was unausweichlich scheint?
Wann immer die Kräfte des niedlichen Satansbraten und – im weitesten Sinne – Hundesohns walten, ist Das Omen enorm effektives Schauerkino mit einigen denkwürdigen Momenten (allein das Affentheater im Safaripark), seine fast apokalyptische Grundstimmung trägt ihn jedoch die ganze Zeit bis zu seinem für Hollywood-Verhältnisse bald schon skandalös pessimistischen, fatalistischen, abgrundtief bösen Finale. Einen oft unabsichtlichen Fehler begeht der Film nie, der ihn nach wie vor wahnsinnig beklemmend macht und jederzeit dicht an der Gefühlswelt des Protagonisten lässt: Unabhängig der dargelegten Fakten – für das Publikum und dessen nahezu allwissenden und irgendwo neutralen Position noch früher und deutlicher – wirkt Damien nie wie das Monster, das er wahrscheinlich ist. Ein kleiner, schüchterner, unschuldiger Junge, dem höchstens mal ein diabolisches Schmunzeln in unpassenden Momente herausrutscht. Wie so vielen Fünfjährigen, ohne dass sie der Sohn des Teufels sein müssen. Die Zeichen sind eindeutig, die Schergen treiben schon längst ihr Unwesen (Rottweiler, der Anti-Kuschel-Hund schlechthin), ihr vermeidliche Führer fällt nie aus seiner Tarnung. Seine Zeit wird erst noch kommen. Beängstigend gut gemacht.
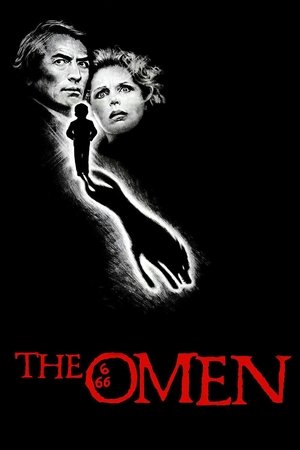 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org
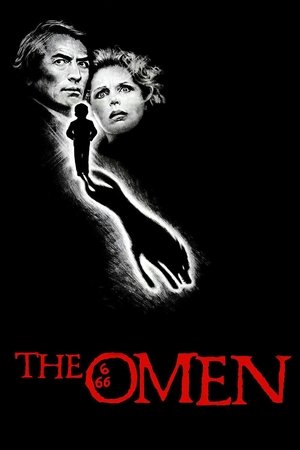














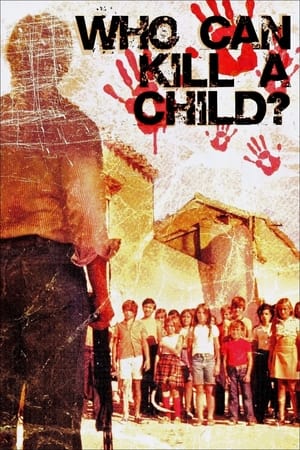



Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!