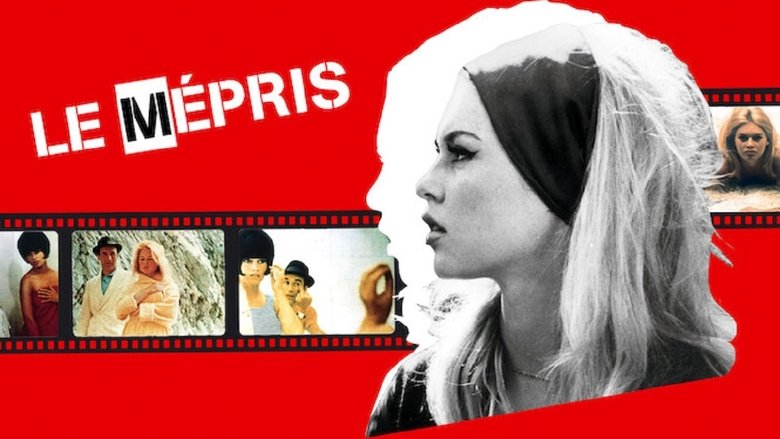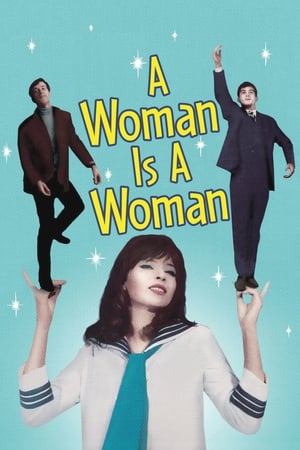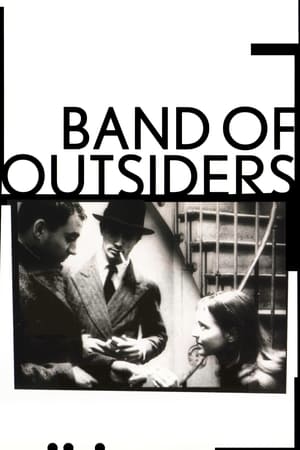Der Franzose Jean-Luc Godard wird oft gleich hinter Orson Welles („Citizen Kane“) als der zweitwichtigste Regisseur aller Zeiten genannt. Das macht bei näherer Betrachtung durchaus Sinn, haben beide doch durch ihr Schaffen und ihre Techniken dem Film weitere Möglichkeiten gegeben. Möglichkeiten, die das Medium zu dem machen, was es heute ist. Tatsächlich kann man, vorausgesetzt, dass man die Arbeit der beiden Künstler kennt, in heutigen Filmen immer wieder darauf achten, welche vorhandenen gestalterischen Elemente durch Welles bzw. Godard eingeführt wurden. Würde man eine Strichliste führen, käme man wahrscheinlich ob der schieren Menge von Linien irgendwann durcheinander. Welles und Godard, Namen die für die Freiheit des Bildes und des Schnittes stehen wie sonst wohl keine dritten.
Allerdings gibt es auch viele Unterschiede zwischen den beiden Filmemachern. Zwar sind sie beide mit ihrem ersten Film auf einen Schlag berühmt geworden, allerdings erlangte Welles in seinem Schaffen nur sehr selten zu einer derart forschenden und selbstreflexiven Darstellungsart wie Godard. Welles liebte es, große bekannte Stoffe umzusetzen, seine Vergangenheit im Theater kam ihm da zu gute. Godard schien es als Verfehlung erachtet zu haben, bei einem Film die Möglichkeit verstreichen zu lassen, kritisch mit dem Medium, der Gesellschaft, sich selbst und mit dem System Hollywood umzugehen. Nicht einmal drei Jahre nach seinem Durchbruch mit „Außer Atem“ hat Godard dann „Die Verachtung“ gedreht, sein achtes Werk und zugleich das erste, das mit großen Stars und großem Budget daher kam. Zum ersten Mal wirkte ein wirtschaftlicher Interessen-Druck auf Godard ein. Und genau darum geht es auch im Film.
Ganz zu Beginn lässt der Franzose von einem Sprecher die Credits zum Film „Die Verachtung“ verlesen. Währenddessen zeigt der Film einen Filmdreh; eine Kamera fährt auf einer Dolly und filmt eine Frau. Die Kamera fährt dabei immer dichter an den Zuschauer selbst heran, schwenkt irgendwann und filmt den Zuschauer selbst, durchbricht die vierte Wand. Die Kamera sieht auf den Zuschauer herab, aber im gleichen Maße blickt sie auf Jean-Luc Godard selbst hinab. Godard untersteht einem dokumentierenden Druck, eben kommerziellen Interessen. Dabei macht er sehr deutlich, als was sein Film, seine Arbeit, sein Schaffen eigentlich anzusehen ist. Als ein Kunstwerk, was nicht als snobistischer Qualitätsanspruch gemeint ist, sondern als das, was es ist. Produziert von einem Menschen. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist eine demütige und leicht bescheidene Sichtweise auf seine eigene Arbeit, die auch als entschuldigende Abwehrhaltung interpretiert werden kann, wenn man sich einmal bewusst macht, wie rigoros Godard doch manchmal in Erscheinung tritt.
Der Film hat mehrere Zentren, die der Zuschauer wie es ihm beliebt gewichten kann. Da wäre zum einen die Beziehung zwischen Paul (Michel Piccoli) und Camille (Brigitte Bardot), zum zweiten das Dilemma zwischen Paul und dem Hollywood-Produzenten Jeremy (Jack Palance) und zu guter letzt die Beziehung zwischen dem Film selbst und der Kommerzialisierung. Die dritte Variante steht natürlich in direktem Verhältnis zu dem zwischen Jeremy und Paul, jedoch wird sie von Godard nicht mithilfe von Figuren, sondern allein über stilistische und filmtechnische Raffinessen erzählt. Kommerz versus Kunst ist hier der Titel des ewigen Boxkampfes ohne Ringrichter. Jean-Luc Godard ist unbestritten ein kritischer Zeitgenosse, wenn es um das amerikanische Kino geht (und das auch zurecht, wenn man sich mal den durchschlagenden Erfolg der Nouvelle Vague anschaut). Nichts scheint ihm unechter, verlogener und primitiver als Kino, das rein kommerziell ausgerichtet ist und es gehört für ihn abgestraft. Er hat Verachtung für den fahrlässigen Umgang mit der Liebe und dem Kino.
Der Filmproduzent Jeremy sagt viele schlaue Sätze in diesem Film. Viele sehr dumme allerdings auch. Zu Beginn sagt er „Zu wissen, dass man nichts weiß, ist die größte Gabe.“, eine Einstellung, die Godard selbst lebt, da er sie auf sein Kino bezieht. Er starte quasi von Null mit der Erfindung einer neuen Bildsprache und habe, weil er sich dessen bewusst ist, die größten Freiheiten. Der Umkehrschluss wiederum lässt sich auf Hollywood beziehen. Es denkt, alles zu wissen und ist deshalb mit dem größten Fluch belegt. Es ist ein zutiefst verqueres weil selbstherrliches Kino. Eines mit falschen Interessen; Jeremy ist nicht wirklich begeistert von Fritz Langs (ja, der Fritz Lang) neuem Film. Seine einzige Regung bezieht sich auf seine Gleichartigkeit mit den Göttern des Olymp und auf die Ansicht von nackter Haut. Da letzteres wie eine kindische Überzeichnung von Godard gewertet werden könnte, sollte man anmerken, dass es sich um eine direkte Verwertung seiner Erlebnisse mit den Produzenten von „Die Verachtung“ handelt, die irgendwann bloß noch an den Nacktaufnahmen von Bardot interessiert waren. Aufnahmen, die Godard mit absurden Dialogen auszuhebeln versucht.
Paul, Drehbuchautor von Beruf, beginnt schließlich mit seiner Arbeit für Jeremys Film, der von Fritz Lang inszeniert werden soll. Er hat sich letztendlich des Geldes zur Arbeit breitschlagen lassen, hat aber ein überaus schlechtes Gewissen deshalb und droht auch noch, seine Frau Camille deshalb und wegen des unkommunikativen Umganges zu verlieren. Wie durch ein Loch in der Wand kommt Camille in einer Szene in den Raum, in dem Paul an seinem Drehbuch schreibt und antwortet kurzerhand auf das, was er vor sich hin gemurmelt hat, während er es abtippte. In diesem Moment verbindet Godard die drei narrativen und reflexiven Ebenen des Films. Der Film als Kunstwerk, die Handlung zwischen Kunst versus Kommerz und Paul selbst mit seiner Beziehung zum Medium Film. Der Kreis schließt sich und das ist so elegant gelöst, dass man aufspringen und applaudieren möchte. Paul, dem alles irgendwann zu viel, hält schließlich ein flammendes Plädoyer gegen die Geldgier als oberste Instanz - und wird prompt von allen allein gelassen. Er findet sich am Boden von nicht enden wollenden Treppenstufen wieder.
Jean-Luc Godard besetzte sich nicht ohne Grund als Assistent von Fritz Lang, der dem Franzosen die Ehre erwies und sich hier selbst spielt. Er ist sein Schüler und Lang ist sein Mentor. „Man soll stets beenden, was man angefangen hat.“ sagt Herr Lang als eine Art letzten wichtigen Satz im Film und spricht damit Godards Zuversicht an. Seine Motivation, seine leichte Müdigkeit, aber auch seinen unbedingten Willen. Man muss sich einmal mehr vor Augen führen: Die Nouvelle Vague war zum Entstehungszeitpunkt des Films gerade einmal drei Jahre alt. Aber auch das scheint eine Gemeinsamkeit zwischen Godard und Orson Welles zu sein. Beide wurden in ihrer Karriere mit immensen Problemen und vielen, vielen verschränkten Armen konfrontiert. Weitergemacht haben sie immer. Beirren lassen haben sie sich nie. Nicht von verschränkten Armen und vor allem nicht von Geldgebern und Finanziers, Welles hat sein eigenes Geld in die Produktion gesteckt und Godard benötigte so wenig, dass er auch so gut auskam.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org