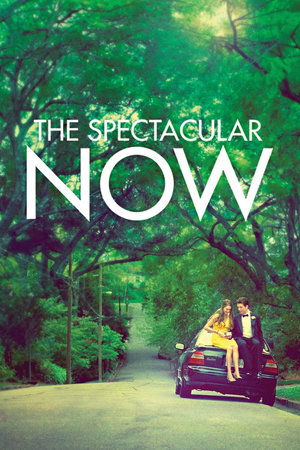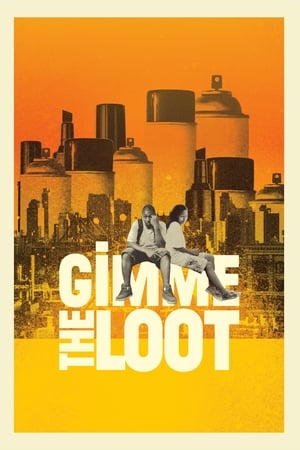Das Sundance-Filmfestival hat einen weltweit legendären Ruf und eine überaus starke Reputation. Und das mit recht, wird doch beinahe jedes Jahr auf’s Neue bewiesen, wenn von den Filmen die Rede ist, die während des Festivals in den verschneiten Rocky Mountains gefeiert wurden. „Dope“ ist eine der jüngsten Ausgeburten dieser Lob-Maschine. Ein überaus kleiner Film, mit durchaus großen Namen im Hintergrund. Forest Whitaker ist der Erzähler, P-Diddy und Pharrell Williams sind als ausführende Produzenten. A$AP Rocky und Zoe Kravitz ("Mad Max: Fury Road") geben sich als Darsteller in Nebenrollen die Klinke in die Hand. Und alles in allem hat der Streifen nicht einmal eine Million US-Dollar gekostet. Eingespielt hat er mittlerweile (eben dank der feucht-fröhlichen Stimmen aus Sundance) weit über 15 Millionen Dollar. Ein durchschlagender Erfolg also, aber auch einer, der die Erwartungen in die Höhe schnellen lässt. Sieger der Herzen in Sundance ist nicht nur ein Segen, sondern manchmal auch ein Fluch.
Und auch „Dope“ dürfte hier und da auf Enttäuschung treffen, falls der Zuschauer sich zu sehr auf die Vorschusslorbeeren versteifen sollte, derer - so viel sei verraten - es auch hier noch in gesundem Maße geben wird. Frenetische Stimmen aus Sundance scheinen oft das Blaue vom Himmel zu versprechen, quasi den besten Film aller Zeiten, obwohl es sich lediglich um einen grundsoliden aber verdammt sympathischen Film handelt. Das passiert des Öfteren und da ist die Enttäuschung beim Publikum groß, wenn erwartet wurde, dass der Film ganz nebenbei das Rätsel des Lebens löst. Das gelingt auch „Dope“ nicht und dieser Film wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein beträchtliches Maß seiner Magie an der Synchronisation verlieren - nicht des Talents der Sprecher wegen (das ist in Deutschland nämlich unbegrenzt), sondern der Unterschiede der deutschen Sprache zum Englischen wegen. Beide Sprachen funktionieren auf komplett verschiedenen Levels, die Macht des Englischen wird hier jedoch genüsslich genutzt. Ein Effekt, der verloren gehen wird, wenn man den Film auf deutsch guckt.
Denn „Dope“ ist ein Film wie ein Lied, auf Rhythmus ausgelegt, in dynamische Wellenform aufgelegt. Ein Coming-of-Age-Film, allein diese Beschreibung dürfte in Verbindung mit dem Wort Sundance zu erhobenen Augenbrauen und reichlich Skepsis führen, der seine Charaktere die drei Bedeutungen von „dope“ durchleben lassen wird. Ein Film, der seine Aussage lebt, ein Herzensprojekt. Ein Werk, dass sich in „Das musste mal gesagt werden“-Gefilde traut, aber auch einige ernste Thematiken und Vorurteile, die zumeist mit der Rassenthematik zu tun haben, sehr entspannt und leicht angeht. Die lesbische beste Freundin von Malcolm (großartig dargestellt von Shameik Moore), die von allen nur „Diggy“ genannt wird, muss da einmal wöchentlich mit ihrer Familie in die Kirche „to pray away the gay“ - um ihre Homosexualität wegzubeten. Ein Ritual, das Diggy (Kiersey Clemons) selbst bloß mit schmachtenden Blicken in Richtung Frauenbeine einer weiteren Kirchgängerin bedenkt.
Es ist generell eine intolerante Welt, in der Malcolm, Diggy und Jibb, der dritte im Bunde und gespielt von Tony Revolori (dem Lobby-Boy aus „Grand Budapest Hotel“), zusammen leben. Sie sind schwarz, werden aber in ihrer Schule von anderen Schülern verprügelt, abgezogen und lächerlich gemacht. Die drei werden ausgegrenzt, weil sie „white shit“ mögen und tun, sie mögen Manga-Comics, fahren Skateboard und BMX, spielen Punk-Musik und sind zu allem Überdruss auch noch gut in der Schule. Malcolms Traum ist es, in Harvard zu studieren, ein Traum, den sein Schulleiter sofort wieder zerstört. Schließlich komme er aus Inglewood. Hier grenzen die ernsten Töne an, die Regisseur Rick Famuyiwa immer wieder anschlägt (und zum Ende hin gewollt überreizt). Das Spiel mit rassistischen Ansichten von beiden Seiten der Medaille und die gesamte Diskussion werden teils auf köstliche Art und Weise behandelt und auf die Schippe genommen. „Dope“ will sich in keine Schublade stecken lassen. Gelingen tut das bis auf eine Ausnahme immer.
Denn bis zum Ende, wenn der Film durch seine knackige Inszenierung und das recht stringente Drehbuch, das sich weder vor Albernheiten noch vor geistreichen Kommentaren scheut, überzeugt, bewirkt der Film genau das, was der Grund für die ekstatischen Reaktionen aus Amerika ist. Der Film ist feinste Lebensenergie, unheimlich lustig, er scheint locker-frisch und ist immer wieder entlarvend - und das mag der Zuschauer. Was er nicht mag, ist, belehrt zu werden. Leider tut „Dope“ das am Ende, wenn er seine durchklingende Aussage nimmt und sie wortwörtlich und mittels Durchbrechen der vierten Wand an den Mann bringt. Die schleimige „Glaub an dich“-Aussage kommt da mit Lichtgeschwindigkeit angerauscht. Man hat keine Zeit, um sich darauf vorzubereiten (weil der Film zuvor nicht den Anschein macht, als hätte er derartige Tricks nötig) und man hat auch keine Zeit, um dieses Manöver danach ruhig ausklingen zu lassen.
Dieser bittere Nachgeschmack bleibt nach dem Film leider erhalten, die besagten Momente wirken ein wenig wie ein Fremdkörper in diesem Film und würden genau das in jedem Film sein. Nun ist die Frage natürlich, wie man da mit umgeht, denn in den neunzig vorangegangen Minuten bewies Regisseur Famuyiwa Stil und Intellekt in seinem Umgang mit Moral und Kunst. Er macht sich ebenso über den Hip-Hop eigenen Hochmut lustig, wie über den unsicheren Umgang der weißen Bevölkerung und über den überempfindlichen Umgang mit der Rassenthematik. Einerseits möchte man da applaudieren, andererseits wird man gezwungen, eine bittere Pille zu schlucken. Was bleibt da unterm Strich? Natürlich das schiere Talent der beteiligten Personen, dass den absoluten Großteil des Films zu einem Erlebnis werden lässt. Die knackige Regie, der gelungene Mix aus bekannten Elementen in einem neuen Korsett, die überaus treffsicher gewählte Musik - das funktioniert wie Sau.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org