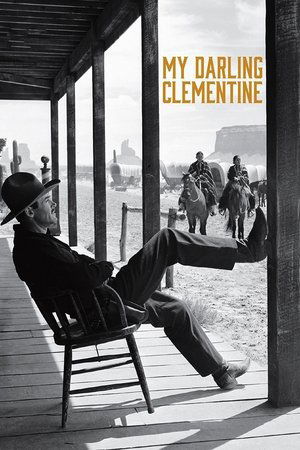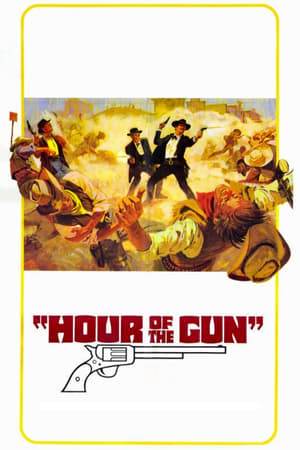Quelle: themoviedb.org
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org

- Start 01.09.1994
- 191 Min ActionAbenteuerDramaKrimiBiografieWestern USA
- Regie Lawrence Kasdan
- Drehbuch Lawrence KasdanDan Gordon
- Cast Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman, David Andrews, Linden Ashby, Jeff Fahey, Joanna Going, Mark Harmon, Michael Madsen, Catherine O'Hara, Bill Pullman, Isabella Rossellini, Tom Sizemore, JoBeth Williams, Mare Winningham, James Gammon
Inhalt
Kritik
Fazit
Kritik: Jacko Kunze
Beliebteste Kritiken
-

Wyatt Earp - Das Leben einer Legende
Ein gut gemeinter Neo Western mit einem grossen Staraufgebot! Kevin Costner versprüht eiserne Härte aber man spürt, dass er in diesem Genre, sich zuhause fühlt. Dennis Quaid spielt ziemlich stark und intensiv. Gene Hackmans Rolle fällt klein aus. Aber wenn er spielt, hat er eine unglaubliche Präsenz. Ein guter Western mit vie...
-

Wyatt Earp - Das Leben einer Legende
Nach 'Der mit dem Wolf tanzt' (1990), produzierte Kevin Costner mit 'Wyatt Earp' sein zweites episches Western-Drama, konnte den Erfolg aber nicht wiederholen. Auch hier wird überwiegend auf Atmo und Darsteller gesetzt, wobei die rudimentäre Story im Hintergrund bleibt. Es ist die Geschichte eines Mannes, der von seinem Vater...
Moviebreak empfiehlt
Wird geladen...
×