„Sagen wir, die erste Fassung hat ein talentierter Dilettant gemacht und die zweite ein Professioneller.“
Das sagte Alfred Hitchcock selbst in der berühmten Interview-Reihe mit François Truffaut über den grundlegenden Unterschied zwischen seinem einzigen Remake und dessen Original. Was furchtbar arrogant klingen mag, wenn nicht bekannt ist, dass er selbst dieser „talentierte Dilettant“ war.
Mit Der Mann, der zuviel wusste drehte Hitch tatsächlich 22 Jahre nach seinem gleichnamigen Film von 1934 eine US-Version, diesmal natürlich unter völlig anderen Vorrausetzungen. Damals war er noch ein zwar auffälliges, aber noch relativ kleines Licht, hatte seinen Stil immer noch nicht vollends ausbalanciert (orientierte sich zu dieser Zeit ja erst deutlicher in die Richtung, die man später als Synonym seinem Namen gleichsetzte) und lieferte für damalige Verhältnisse aber bereits eine recht aussagekräftige Blaupause für sein späteres Schaffen ab. Ein sehr ambitionierter Film mit einigen erinnerungswürdigen Momenten – durchaus ein Wegbereiter -, dem es an Möglichkeiten und Erfahrungswerten mangelte. Somit absolut logisch, dass Hitchcock von seinen vielen Frühwerken ausgerechnet dieses auswählte, damit es eine moderne, überarbeitet Frischzellenkur erfuhr. Nur hier war die Diskrepanz von Theorie und Praxis mit so viel verwertbarem Potenzial nun sinnvoll aufzuheben.
Klimawechsel schon zu Beginn: Vom frostigen Skiurlaub in der Schweiz geht es ins brütend heiße Marokko für eine nicht mehr britische, nun US-amerikanische Oberschicht-Familie, was am Ort des legendären (und bis auf das Feintuning sehr identischen) Showdowns nichts ändern soll. Es sind grundsätzlich nur Details die angepasst werden, viele davon aber entscheidend und sinnvoll. So bleibt die Grundprämisse praktisch unangetastet. Hitch weiß sehr wohl, was beim ordentlichen Vorgänger funktionierte. Behebt nur analytisch die Schwachstellen. Wirkte der Erstling noch arg gehetzt und mitunter fast sprunghaft voran stolpernd, ist das Remake weitaus geduldiger, überlegter. Aufgrund des internen „Fehler-Protokolls“ natürlich auch in der vorteilhaften Lage genau zu wissen, was in den Vordergrund zu stellen ist. Stellvertretend dafür der Vorspann, währenddessen der Zuschauer bereits klar darauf hingewiesen wird, worauf er in der entscheidenden Phase zu achten hat.
Ein Beckenschlag als großer Höhepunkt eines Suspense-Crescendo, wie maßgeschneidert für das Kino von Alfred Hitchcock. Darauf arbeitet er nun gezielt hin, auch wenn es knapp 70 Minuten dauern soll, bis das Publikum das in einen effektiven Zusammenhang bringen kann. Und - so unvorteilhaft das irgendwie klingen mag -, ab dann kommt Der Mann, der zuviel wusste auf Augenhöhe mit den großen Klassikern aus dem Werk-Katalog des Meisters. Erst, mag man zunächst in diese Worte hinein interpretieren. Aber es spricht eher für die inzwischen vorhandene Routine und das Wissen, wie sich echter Suspense allmählich aufbauen, kontinuierlich entwickeln und dann konzentriert entladen sollte. Genau genommen ist der einzig echte Haken an Der Mann, der zuviel wusste, dass er diesen perfekten Höhepunkt verpasst und sich genötigt fühlt (was im Original nicht der Fall war), ein zweites, ein zusätzliches Finale hintendran zu hängen, das es nun wirklich nicht gebraucht hätte. Der Effektivität der famosen Highlight-Sequenz in der Royal Albert Hall (bei der Hitch seine Stummfilm-Lehrjahre deutlich zu Gute kommen) nimmt das nicht ihre Klasse, es entwertet sie aber rückwirkend leicht in ihrer Positionierung. Dem atemberaubenden Hauptkampf folgt ein zaghaftes Gerangel, das zwar nicht schlecht ist, aber sollte man nicht dann aufhören, wenn es am schönsten ist? Hat schon seinen Grund. Wurde wohl auch so angewandt, weil der werbeträchtig als sinnvoll angesehene Einsatz von Doris Day’s Song „Que Sera, Sera“ noch eine narrative Relevanz bekommen sollte. Hat dahingehend funktioniert: Das Lied kassierte einen der wenigen Oscars, die ein Hitchcock-Film bei über 50 Anläufen einheimsen sollte. Darüber sollte man bei genauerer Betrachtung eher traurig als erfreut sein.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org














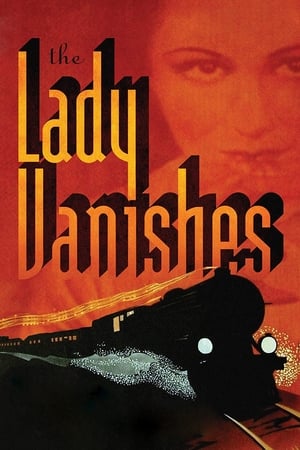


Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!