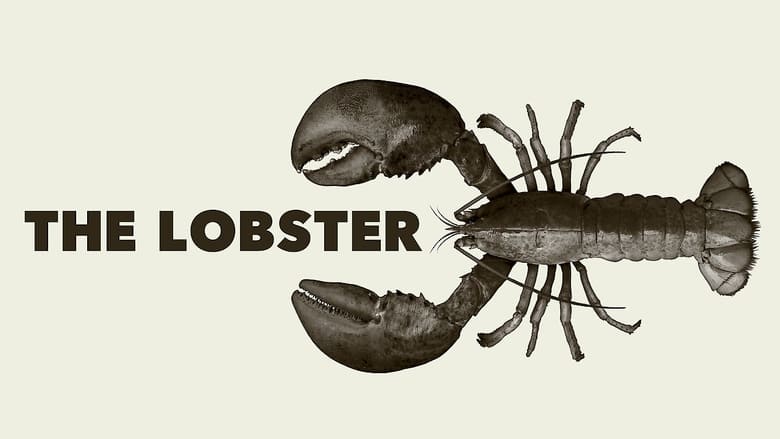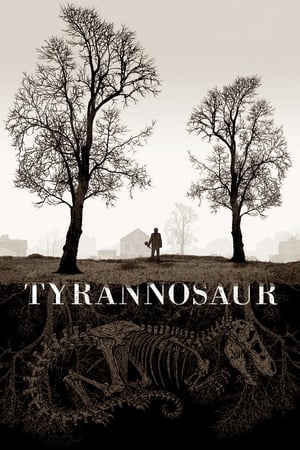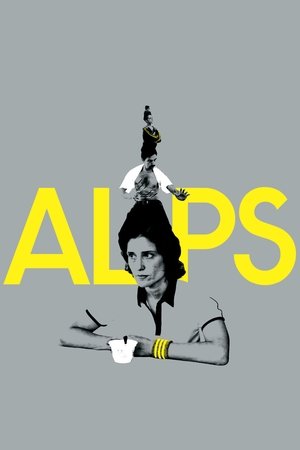Der griechische Filmemacher Giorgos Lanthimos, den die meisten wahrscheinlich von seinem 2009 erschienenen Film „Dogtooth“ kennen werden, hat mit dem Film „The Lobster“ seine erste englisch-sprachige Arbeit abgeliefert und damit ordentlich Erfolge gefeiert. In diesem Jahr (2015) gab es dafür den Jury-Preis beim wichtigsten Filmfestival der Welt in Cannes. Aber das war wohl nur die Krönung der Reise, die Lanthimos bis dahin mit seinem Film beschritten hat. Schließlich gehört schon etwas dazu, Colin Farrell, Rachel Weisz, Ben Whishaw, Lea Seydoux und John C. Reilly in seinen Film zu bekommen. Lanthimos hat es geschafft und dabei wohl hauptsächlich durch die überaus interessante, recht zynische Geschichte, die aber mit zartem Kern daherkommt, zu überzeugen gewusst.
David (Farrell) ist auf einmal wieder Single. Er weint nicht in den Momenten nach der Trennung und er findet es immer lächerlich, wenn in Filmen wie auf Knopfdruck in Tränen ausgebrochen wird. Er findet, man denkt und fühlt und tut zwar viel, wenn der Partner Schluss macht, aber weinen tut man nicht. David hat einen undefinierbaren Haarschnitt, einen kleinen Schnauzbart, eine rahmenlose Brille und einen kleinen Bauch. Er ist kein Hingucker, definitiv nicht jemand, der wirklich auffällt oder aufzufallen versucht. Er trottet den ganzen Film über nur herum, er blickt um sich, ohne wirklich etwas zu sehen (und das ist nicht seiner Kurzsichtigkeit geschuldet), er gerät nie so richtig in Rage - zumindest nicht in der ersten Stunde. David ist allein und das ist das Problem, denn in dieser Welt ist das Singledasein keine Option. Sofort wird er abgeholt, darf seinen Hund/ Bruder mitnehmen und findet sich in einer Einrichtung wieder, in der alle Singles der Region eingesperrt werden. Von nun an hat er 45 Tage, um eine Partnerin zu finden und sich zu verlieben, sonst wird er in das Tier seiner Wahl verwandelt und ausgesetzt. Das Tier seiner Wahl ist ein Hummer.
Diese Ausgangssituation klingt allein schon wahnwitzig, wie Material für eine große Satire - und dem ist wohl auch so, aber ist dies mitnichten Lanthimos’ primäres Ziel. Eigentlich wird hier eine recht schwarze romantische Komödie erzählt und mit beißender Gesellschaftskritik verbunden. Satirisch und humorvoll geht es hier natürlich zu, aber nicht für die Figuren im Film, sondern nur für den Zuschauer. Lachen tut hier keiner der Charaktere, nie. Nicht, bei all den Sprüchen und absurden Situationen, bei denen der Zuschauer sich kringelt und nicht in den Situationen, in denen es nichts mehr zu lachen gibt. Freude ist hier Stille, weil sie Ruhe bedeutet. Und Ruhe bedeutet Sicherheit. Liebe allerdings ist Hingabe, Liebe ist Gemeinsamkeit, der Wille zur Veränderung. In der Liebes-Einrichtung sieht das etwas anders aus. Da ist Liebe nichts anderes als ein berechenbarer Algorithmus. Die Einzigartigkeit wird damit als unnütz weggeworfen, Risiken werden ausgeschlossen, Emotionen ebenso. Rationale Entscheidungen sind das höchste Gut, das einzige Gesetz, in einer Welt, in der man in ein Tier verwandelt wird. Man solle aber aufpassen, welches Tier man sich wünsche, weil man als Tier nur mit seinesgleichen verkehren kann - schließlich wäre alles andere absurd.
„The Lobster“ gibt sich sichtlich Mühe, um seine zwei Stunden immer weiter mit schrulligen Dialogen, absurden Situationen und (mit fortschreitender Laufzeit) zutiefst tragischen Gefühlen anzureichern. Mehrmals gehen die „Patienten“ der Liebeseinrichtung auf die Jagd, wo sie Menschen mit Betäubungspfeilen abschießen können, die von der Einrichtung geflohen sind und als Gruppe leben, in der jegliche Romantik und Liebe untersagt ist. Immerhin droht aber hier nicht die Verwandlung. Sobald ein Patient einen der Einsamen betäubt, bekommt er einen weiteren Tag in der Einrichtung gut geschrieben. Der Jagd wird hier eine fast schon episch-religiöse Bedeutung beigemessen. Lanthimos inszeniert sie mit poetischer Kraft und mystischer Tragik, wenn in diesem saftigen Walde Menschen rennen, stolpern und fallen, dumpfe Schüsse abgefeuert werden und die gerötete Haut in Zeitlupe unter der Kraft der Fäuste erschüttert. Das Gezeigte sind hier jedoch keine Endzeiten, es ist viel mehr die Renaissance der Barbarei.
Der gesellschaftskritische Grundgedanke des Werkes, in einer Zeit zu existieren, in der jeder Single als minderwertig angesehen wird, jedes unverheiratete und selbstständige (nicht einsame!) Leben als vergeudet, ist nicht nur zufällig an vergangene Zeiten angelehnt. Schließlich ist die Vernichtung des Menschenlebens so vieler nichts anderes als Euthanasie. Auf der Einsamkeit wird hier in kräftigster Absurdität herumgeritten. Vom drohenden einsamen Erstickungstod bis zur Bestrafung biblischen Ausmaßes wegen Masturbation. Die Hand wird dem lispelnden Mann zwar nicht abgehackt, aber sie wird in einen eingeschalteten Toaster gesteckt. Er spielte und verbrannte sich an der Flamme der Sünde. Der Film macht sich jedoch, und das ist ein wichtiger Unterschied, der vielleicht nicht jedem sofort deutlich wird, nicht hauptsächlich über die Einrichtung an sich lustig, sondern über die Menschenmasse, die ihr folgt. Deutlich wird das, wenn absurde Gedanken (wie eben der Erstickungstod beim alleinigen Abendmahl) mit frenetischem Applaus der Patienten begrüßt werden.
„The Lobster“ wird wahrscheinlich, falls ihm denn ein bundesdeutscher Kinostart vergönnt sein wird, auf ein paar skeptische Gesichter treffen, und das ist vollkommen in Ordnung. Das liegt in der Natur der Sache. Nun ist es jedoch die Aufgabe einer jeden Zuschauerin, eines jeden Zuschauers, hinter diese Wand der Skepsis zu lugen und sich bereit zu erklären, dem Film mehr als eine Ebene zuzutrauen. Farrells Schauspiel ließe sich, unter gewöhnlichen Gesichtspunkten, als steif, aufgesetzt und dilettantisch bezeichnen. Natürlich ist dieser Vorwurf komplett danebengeschossen. Denn in Farrells Darbietung liegt etwas wirklich meisterhaftes. Die Aufgesetztheit, mit der er all seine Dialoge vorträgt, wirklich alles klingt hier vorgelesen, irgendwie statisch und glanzlos, ist wohl eines der deutlichsten stilistischen Elemente, die Lanthimos satirisch nutzt. Es unterstreicht die aufgezwungene Natur der zwischenmenschlichen Beziehungen, die hier so künstlich organisiert werden sollen. Die Dialoge weisen absichtlich Unzulänglichkeiten auf, vor die jeder Drehbuch-Dozent warnt, das Gesprochene wirkt hier teilweise wie ein Theaterstück, das von Amateuren verfasst wurde.
Und dennoch nimmt die Qualität des Filmes dadurch nicht ab, im Gegenteil. Denn „The Lobster“ zeigt eine Welt, in der Gegensätze aus unserer Welt gespiegelt wiedergegeben werden. Auf inhaltlicher Ebene funktioniert das fast selbstredend, auf stilistischer Ebene durch erwähntes Stilmittel der seltsamen Darbietungen. Das aufgesetzte Spiel sorgt dafür, dass David fast wie ein Kind wirkt, naiv, herzensgut und unschuldig, er wird ein emotionales Zentrum in einer Welt, die dieses eigentlich verleugnet. Er wird ein emotionales Zentrum, obwohl Emotionen gar nicht sein Fachgebiet zu sein scheinen. Nicht zuletzt führt diese polarisierte Gegensätzlichkeit zu einem Film, der an vorderster Front erst einmal pechschwarz und unheimlich zynisch daherkommt, der in seinem Kern aber gefühlvoller nicht sein könnte. In Momenten der (erst aufgezwungenen, später verbotenen) Zweisamkeit nämlich wird das große Herz real, dass der Film anscheinend erst zu unterdrücken versucht und dann aber doch langsam an die Oberfläche kommen lässt.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org