"Write like you wrote it that way on purpose" — diesen Ratschlag gibt Arthur Witzler Jr., der von Bill Murray (Broken Flowers) gespielte Gründer der fiktionalen Gazette The French Dispatch, jedem seiner Redaktionsmitglieder mit auf den Weg. Es ist nicht davon auszugehen, dass Regisseur Wes Anderson sich eines solchen Mantras selbst jemals erinnern müsste, das er seiner eigenen Figur hier in den Mund legt, schließlich findet sich auch in The French Dispatch, seiner Hommage an das vermutlich einflussreichste Magazin im englischsprachigen Raum, den New Yorker, keine Einstellung, die nicht vor Formbewusstsein strotzt.
Die Liebe zum Detail ist bei Anderson weniger Phrase denn oberste Voraussetzung seiner Projekte. Sie findet sich in den Sets, die in ihrem Handwerksanspruch an die Filme der 20er und 30er Jahre erinnern, als Filmemacher wie Fritz Lang an technische und/oder finanzielle Zwänge gebunden waren und das Drehen on location noch kein großes Thema war. Aus der Not entwickelte sich eine Tugend, und mit den "alten" Mitteln des Theaters verwandelte man die Studios immer wieder in neue Welten. Eine ähnliche Detailversessenheit wie für das Setdesign findet sich auch insbesondere in der Kameraarbeit; eine Kamera, die niemals sucht, die auf den Millimeter genau weiß, wo der Bildauschnitt beginnt und wo er endet. Sie findet sich im Schauspiel, das sich häufig genug einzig auf die Mimiken des überbordenden Ensembles und ihr Arrangement im Schnitt reduziert und aufgrund dessen besonderer Sorgfalt und Genauigkeit bedarf. Das Theaterhafte und die Akribie finden sich in The French Dispatch, Andersons Nachfolger zum Stop-Motion-animierten Isle of Dogs, auf besonders kondensierte Weise wieder.
Die Idee, dem New Yorker ein filmisches Denkmal zu setzen, ist vermutlich ähnlich nischig, wie sich eine Baseballkappe der New York Yankees aufzusetzen oder oder sich in Wimbledon als Roger-Federer-Anhänger*in zu erkennen zu geben. Der fiktive French Dispatch, der sich in Andersons eigenem Cinematic Universe einst als Beilage der Liberty Kansas Evening Sun gründete, ist indes mehr als Rahmen zu verstehen, um drei voneinander unabhängige Kurzgeschichten zu erzählen, die es Anderson erlauben, so viele hochkarätige Stars wie eben möglich in den 108 Minuten unterzubringen. Dem Impuls, diese Riege nun genüsslich vorzutragen, sollte man dennoch wiederstehen, zu wahllos kommen ihre Auftritte bisweilen daher, so lieblos sind sie in die Handlung eingebunden. Anderson scheint sich dieser Gefahr zumindest bewusst zu sein, ist es doch nicht ohne Augenzwinkern, wie sich der Film über die Flüchtigkeit des Auftritts Willem Dafoes (The Florida Project) belustigt. Bedauernswerterweise transportiert Andersons Metakommentar weder besonderen Geist, noch Witz, erscheint stattdessen vielmehr durch Pflichtschuldigkeit motiviert. Denn die alleinige Anerkennung eines Defizits hat noch selten über das Defizit selbst hinweggetäuscht.
Das Problem, nicht ganz zu wissen, was man mit dieser Darsteller*innenriege so anstellen soll, sobald man diese erst einmal versammelt hat, ist allerdings nicht das augenscheinlichste Problem, mit dem Anderson hier auf bislang beispiellose Weise zu kämpfen hat. Wesentlich schwerer wiegt der Umstand, dass Anderson hier eine Komödie vorlegt, die selten lustig ist, dass die Anderson-typische Schrulligkeit hier zu einer kalten Demonstration seines inszenatorischen Talents verkommt, dem bei all den Kamerafahrten, den Sets und den in doppelter Geschwindigkeit vorgetragenen Dialogen der emotionale Kern verloren gegangen ist, der noch The Grand Budapest Hotel oder Moonrise Kingdom, ja sogar den politisch regressiven Isle of Dogs ausgezeichnet hatte.
Dies ist insbesondere bedauerlich, als die Prämisse sich durchaus vielversprechend anschickt. Für eine Jubiläumsausgabe des Magazins findet sich die Redaktion zusammen, um drei Artikel auszuwählen, die innerhalb der vergangenen Dekade von besonderer Bedeutung waren. Was auf dem Papier wie eine gleichsam charmante wie elegante Rahmung daherkommt, wird vom Texaner nur auf äußerst umständliche Weise verwoben. Das ist umso bedauerlicher, als sich sowohl in den drei Vignetten, an die uns die Redakteur*innen nacheinander erinnern, als auch in der Rahmung um die Chefredaktion erzählerisches Potential abzeichnet, das sich in der Folge niemals einzulösen vermag.
Um einen inhaftierten Finanzbetrüger geht es da etwa, ein depressiver Benicio del Toro (Sicario), der sich während seiner zwanzigjährigen Haftstrafe als Maler neu erfindet und seine Gefängniswärterin Léa Seydoux (Blau ist eine warme Farbe) vom täglichen Aktstehen Überzeugen kann, bis diese ihm am Ende einer jeden Session wieder die Zwangsjacke anlegt. Dann ist da Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), der sich als Wortführer der französischen Studierendenbewegung einen schmalen Schnurrbart hat stehen lassen und durch den Gewinn einer Schachpartie das Recht auf Jungsbesuche in den Mädchenwohnheimen zu gewinnen sucht. Ein gewisser Druck also, dem er mit einer Affäre mit der von Frances McDormand (Nomadland) gespielten arrivierten Journalistin Lucinda Krementz entgegenwirkt, die ihm darüber hinaus, zum Unmut seiner Mitstreiter*innen, beim Verfassen eines politischen Manifestes unterstützt. Und schließlich erinnert man sich in der Redaktion gern eines dritten Stückes über einen Entführungsfall, dem der an James Baldwin angelehnte Restaurantkritiker Roebuck Wright (Jeffrey Wright, Westworld) im Rahmen seiner Arbeit an einem Feature über den Küchenmeister der lokalen Polizeiwache, dem Lieutenant Nescafier (Steve Park, Do the Right Thing), einst beiwohnte.
Selbstredend sprühen all diese Episoden nur so vor visuellen Einfällen, immer weiter fährt die auf Schienen befestigte Kamera in die eine oder andere Richtung von einer Szenerie in die nächste, sodass es beinah den Eindruck erweckt, als habe Anderson hier ein schier endlos langes Studio gebaut, dessen Grenzen sich im Zweifelsfall eher als zeitlich denn räumlich herausstellten. Eine ähnliche Form der Reizüberflutung lösen die in höchstmöglich vorgetragener Geschwindigkeit vorgetragenen Dialoge aus. Vorgetragen ist indes das Stichwort, erreicht die Artifizialität in The French Dispatch doch unrühmliche neue Höhen. Wie die meisten Leute, die den New Yorker abonnieren, diesen wohl selten jemals von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen haben, so lässt sich auch das Dialogbombardement in The French Dispatch betrachten. Alles scheint irgendwie da, alles verfügbar zu sein, doch letztlich möchte man es sich dann doch mit dem Herzstück, der Geschichte gemütlich machen, an der sich der Texaner jedoch nicht besonders interessiert zeigt, was zur Folge hat, dass alles steril und kalt wirkt, zur Behauptung gerät.
Selbst wenn man sich an dieser neuen Kälte nicht weiter störte, wenn man zurecht auf die unverwechselbare Präzision des Anderson-Stils verwies, der sich hier womöglich mehr denn je als Meister der Filmhandwerkskunst beweist, so müsste dem entgegengehalten werden, dass neben dem Herz auch der Humor verlorengegangen ist. Seltsam abgestanden und uninspiriert kommt dieser daher, ganz so, als habe sich Anderson ohne weitere Überlegungen auf seine Greatest Hits verlassen und stattdessen alle Energie in das Setdesign, die Kostüme und die Überzeugungsarbeit gelegt, um auch noch die letzten Darsteller*innen für die kleinsten Nebenrollen zu gewinnen.
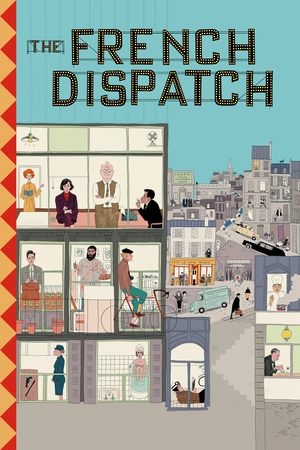 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org
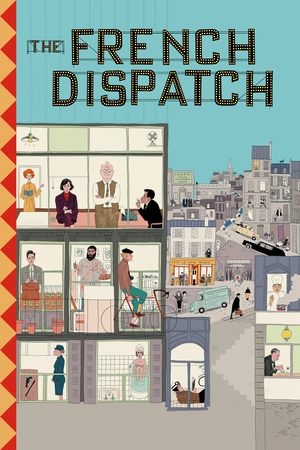





















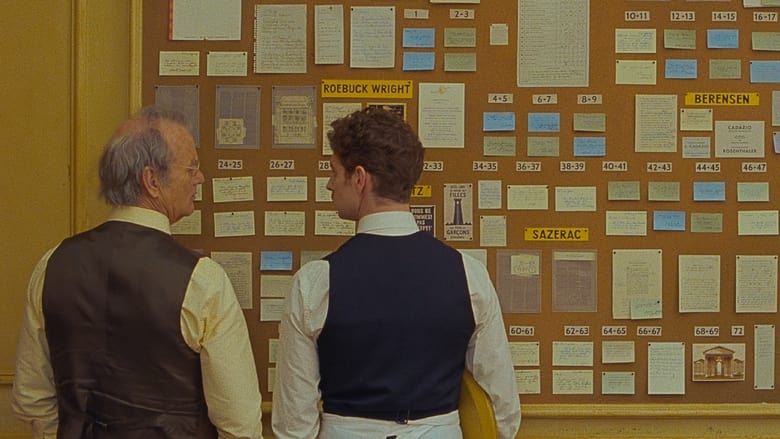

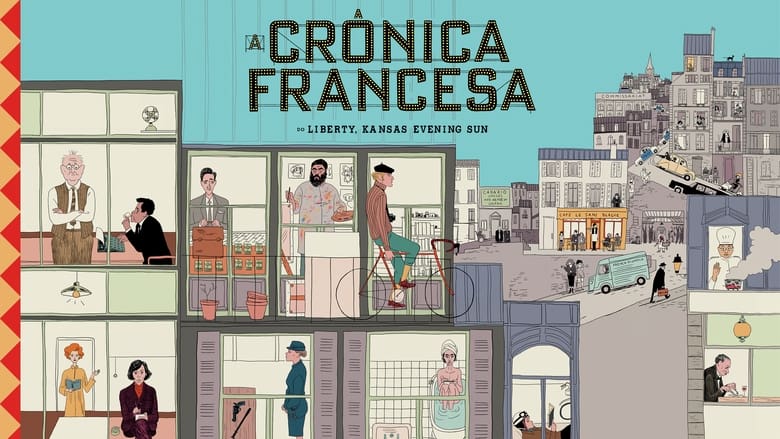


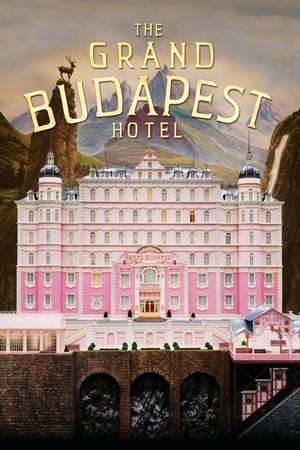
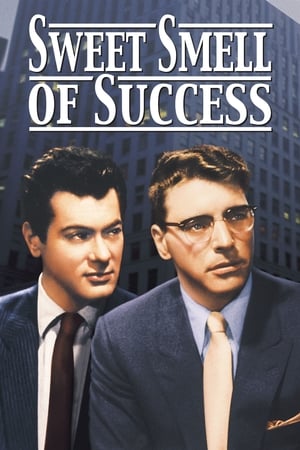
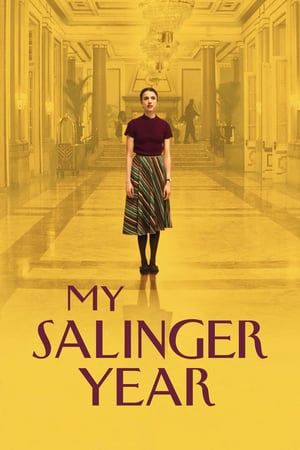
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!