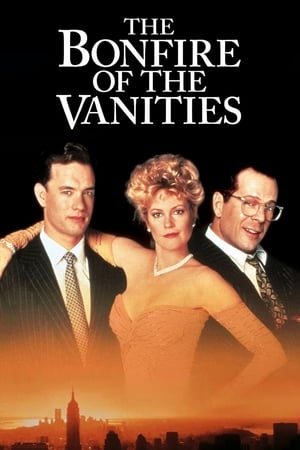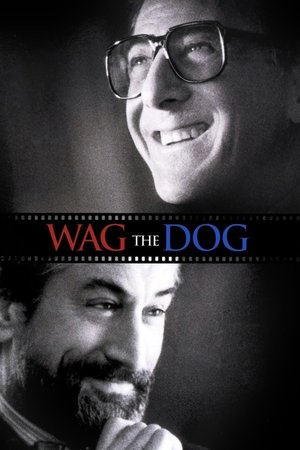Brian De Palma (Passion) ist in seiner langjährigen und äußerst abwechslungsreichen Karriere schon einige Male auf die Nase gefallen. Von Filmen, die eigentlich ein großer Erfolg werden sollten, dann aber doch hinter den kommerziellen Annahmen zurückblieben und reichlich Schelte von den Kritikern wegstecken mussten, kann der Amerikaner wohl ein Lied singen. Vor allem im neuen Jahrtausend hat De Palma so rein gar keinen dicken Fisch mehr an Land ziehen können. Einen derart herben Schuss vor den Bug wie er ihn mit Fegefeuer der Eitelkeiten Anfang der 1990er Jahre aber kassierte, musste De Palma danach nie wieder erleben. Die Adaption des innig verehrten Romans von Tomas Wolfe brach an den Kinokassen katastrophal ein und wurde zu einem DER Kolossalflops der Filmgeschichte erklärt, während die Kritiker sich wieder mal einen Spaß daraus machten, auch aufgrund der enormen Erwartungshaltung, die De Palma einfach nicht erfüllen konnte, immerzu auf die entlarvende Gesellschaftssatire einzuprügeln.
Aber ist Fegefeuer der Eitelkeiten nun wirklich so furchtbar misslungen, wie es die Welt seit jeher postuliert? Oder haben wir es hier wieder mit einem missverstandenen Werk zu tun, was bei De Palma ja bekanntlich auch keine Seltenheiten darstellt? Während der Sichtung von Fegefeuer der Eitelkeiten ereilen den Rezipienten gemischte Gefühle – Allerdings nur in dem Fall, wenn man sich von der renommierten Vorlage abkapseln kann respektive sie nie gelesen hat, was in diesem Fall wohl Glück für De Palma bedeuten sollte. Mit einer gewohnt beachtlichen Plansequenz, in der uns De Palma schildert, wie der Erzähler der Geschichte, Peter Fallow, gespielt von Bruce Willis (Stirb Langsam), zu der Ehrung seines Buches eintrifft und sturzbetrunken durch die belebten Gänge unterhalb des Festsaals poltert. Ein Prolog, an den das Drehbuch zum Ende wieder anschließen wird und den erfolglosen Säufer zum erfolgreichen Säufer befördert, doch bis dahin vergehen gute zwei Stunden. Zwei Stunden, in denen wir den eigentlichen Hauptdarsteller Sherman McCoy, gespielt von Tom Hanks (Captain Phillips), vorgestellt bekommen und Teil seines gesellschaftlichen Niedergangs werden.
Und dieser zentrale Niedergang dient dem Einblick in ein Amerika, in dem die inhärenten Vorurteile, der Narzissmus, die Heuchelei und der Rassismus vorherrschen. Die oberen Zehntausend genießen ihren luxuriösen High-Society-Standard, titulieren sich selbst als 'Master of the Universe', um dann bei einer winzigen Ungereimtheit, einem Moment, in dem die Aufmerksamkeit nicht strikt nach vorne gelenkt ist, vollständig zu Staub zu zerfallen – so wie eben auch Sherman McCoy. Einem Mann, der im materiellen Reichtum schwimmt, der sich neben seiner Frau noch mit einer dickbusigen Blondine vergnügt, wird alles genommen, weil ihm das Leben eine Rechnung ausstellte, die er nicht mit Diplomatie und Rationalität begleichen konnte. Und die Crux an der Geschichte? Er ist unschuldig, denn seine Liebelei saß am Steuer und hat einen Afroamerikaner in der Bronx angefahren, nachdem die beiden eine falsche Ausfahrt genommen hatten. Das Schicksal allerdings scheint um McCoy bereits gestellt und die Mühlen der Justiz, der Politik und der Presse zermahlen ihn Stück für Stück. Die Folge? Frau weg, Geld weg und von den schwarzen Mitbürgern und jüdischen Karrieristen quasi dem Tode geweiht. Ja, Fegefeuer der Eitelkeiten besitzt auch filmisch eine gezielt satirische Sichtweise auf soziale Rangordnungen und die Charakteristika jener Klassenideologie, die sich gewiss durch die Ethnien differenziert.
Was Fegefeuer der Eitelkeiten aber das Genick bricht, ist seine Scheu, wirklich etwas zu wagen. Das Drehbuch von Michael Cristofer ist satirisch verstrickt und zuweilen auch treffend kritisch im Umgang mit dem Sujet. Aber es ist nie zynisch genug, um wirklich etwas über die Moral respektive Unmoral dieser differenten Gepflogenheiten, ja, eigentlich über ganz Amerika, aussagen zu wollen. Wenn Tom Hanks alle Stadien durchwandert hat, ihm nichts mehr bleibt und Peter Fallow als Fledderer einer medialen Leiche Profit aus dieser Tour de Force zieht, dann verstummt die Bissigkeit und Morgan Freeman (Sieben), ausgerechnet Morgan Freeman, darf ein muffiges Plädoyer über den Wert der Gesetzes und die Gerechtigkeit in einem gesellschaftlichen System herausknüppeln, in dem er den gesamten Vorlauf durch seinen Appell an die Prinzipien des Menschen konterkariert und in ein mehr als unnötiges Finale driften lässt. Ein Film, der die meiste Zeit eh schon auf Sparflamme brodelt, verschandelt sich und seine Thematik der Anbiederung wegen letztlich selbst.
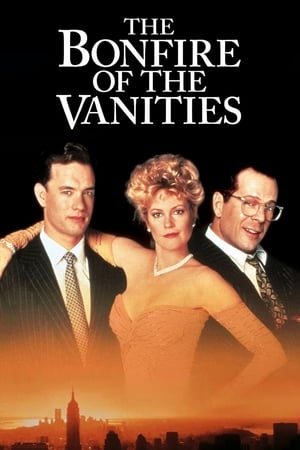 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org