Bis heute hat der inzwischen 90jährige Chilene Alejandro Jodorowsky in einem Zeitraum von 51 Jahren lediglich 8 Spielfilme inszeniert, seine drei bekanntesten (Fando y Lis, El Topo, Montana Sacra – Der heilige Berg) in den ersten fünf davon, sprich zwischen 1968 und 1973. Danach passierte 7 Jahre nichts bis Tusk, woraufhin wieder neun Jahre ins Land gingen, bevor Santa Sangre 1989 schließlich seine Weltpremiere feierte. Das Warten hat sich zweifellos gelohnt, denn was der jeher unberechenbare Filmemacher hier für ein spezielles Ungetüm auf das Publikum loslässt, ist kaum durch wenige Worte in seinem gesamten Umfang auch nur anzureißen. Vergleiche, Parallelen, vermeidliche Inspirationsquelle, das lässt sich natürlich in knappen Schlagworten an die Pinnwand heften, die besondere Qualität ergibt sich jedoch erst aus der ungewöhnlichen Komposition, die so nur wenige überhaupt in Angriff nehmen würden – wovon auch noch der Großteil krachend scheitern müsste. Nicht so dieses positiv verrückte Genie, dessen individuelle Handschrift eine surreale Groteske zwischen Familientragödie, Coming-of-Age-Drama, pechschwarzer Komödie, verstörendem Psychothriller und zünftigem (Italo-)Horrorfilm zu Papier und schließlich auch auf die Leinwand zaubert, die einem mit zusehender Laufzeit immer mehr den Atem raubt.
Fenix (Axel Jodorowsky, der Bruder des Regisseurs) haust wie ein wildes Tier in einer psychiatrischen Einrichtung, hat er doch in seiner Kindheit Schreckliches erlebt. Die erste Hälfte verlief noch relativ unbeschwert, sieht man mal von dem allgemein schwierigen Leben als Zirkusdarsteller-Kind und den extrem problematischen Familienverhältnissen ab. Sein Vater, Direktor des „Circo del Gringo“, ist ein brutaler Säufer, der angeblich aus den USA flüchten musste, nachdem er dort eine Frau ermordet hat. Seine Mutter Concha (Blanca Guerra, Walker) hingegen eine religiöse Fanatikerin und Oberhaupt einer eigenwilligen Glaubensgemeinschaft, die ein einst verstümmeltes und vergewaltigtes Mädchen zur Heiligen auserkoren hat. Damit hat sich der Junge recht gut arrangiert, bis eines Tages die kuriose, aber wenigstens als intakt vorgelogene Parallelwelt brutal in sich zusammenfällt. Es beginnt mit der Affäre seines Vaters, oder ganz konkret als Fenix seine Eltern beim rüden Versöhnungssex im Stroh erwischt. Schlagartig endet seine Kindheit, unmittelbar symbolisiert durch den Todeskampf seines geliebten Elefanten, der anschließend in einer Art skurrilen Staatsbegräbnisses zu Grabe getragen wird. Oder genauer gesagt an den Hang eines Slums, wo er trotz des vorher übertrieben anmutenden Aufrisses einfach abgekippt wird und sich die ausgehungerten Bewohner postwendend über den Kadaver hermachen.
Eine kleiner, aber auffälliger Seitenhieb gegen soziale Schieflage und un-proportionale Kuriositäten, wie auch schon zuvor beim Einreißen der ketzerischen Glaubensstätte dem moralisch entsetzten Monsignore womöglich pädophile Tendenzen angedichtet werden, umgibt er sich doch mit einem blutjungen und offenbar sehr gefügigem Lakaien. Wichtig, oder eher traumatisch, bleibt dieser Punkt der Handlung aber für die Figur des jungen Fenix, den sein Vater nun persönlich meint, zum Mann machen zu müssen. Durch ein Tattoo auf der Brust, die Signatur wie Brandzeichen, aber selbst das ist erst der Anfang. Trauer, Schmerz und Tod, sie sind die Schwelle zur plötzlich und überstürzt über Fenix einbrechenden Adoleszenz, mündend in seiner Katastrophe nicht zu verkraftenden Ausmaßes. Deutet der Film bis dato noch eine latente Romantik - auch wenn natürlich schon schwermütig behaftet - zwischen den Zeilen an, wird spätestens jetzt alles brutal zerstört. Führt zum harten, narrativen Cut in die Gegenwart. Schafft die erklärende Brücke zu dem Wrack, das uns am Anfang bereits präsentiert wurde. Aber jetzt geht es ja erst richtig los…
Santa Sangre entwickelt und bestätigt sich in der Folge als völlig unberechenbare Farce, die sich bewusst nicht festnageln lassen will, sondern gerade in der abnormen Ko-Existenz der Elemente erst seinen exzentrischen Reiz herauskristallisiert. Produzent Claudio Argento hätte mal lieber seinem Bruder – Genre-Legende Dario Argento – direkt in das Projekt involviert, so hätte er seiner legendären Mutter-Trilogie nach Suspiria und Inferno doch noch ein würdiges Finale beschert – und uns wäre das Spät-Debakel namens The Mother of Tears erspart geblieben. Die Filme von Alejandro Jodorowsky wirken oft so als stammen sie aus einer parallel existenten Daseinsebene. Zeigen zwar die Realität, aber wie durch einen Filter. Gebrochen auf der Wasseroberfläche und verzerrt reflektiert. Theoretisch wahrheitsgetreu, aber im Detail merkwürdig zurückgeworfen. Greifbar, dennoch leicht irritierend, entrückt und einer eigenen Logik folgend. Santa Sangre vermischt fast spielerisch etliche Elemente aus Arthouse- und Genrekino, die sich isoliert und in dieser radikalen Form eher abstoßen als anziehen. Das Besondere dabei: Sie finden oftmals nicht getrennt voneinander, sondern in der Regel sogar kombiniert, gleichzeitig oder wenigstens in direkter Abfolge statt, was in der Theorie schier unmöglich scheint. Wenn nicht eines davon den Kürzeren zieht und somit störend wirkt.
Davon ist hier keine Spur. Aus dieser sonderbaren Kreation erschafft Jodorowsky ein mutiges, clever durchdachtes, überraschendes und sowohl verstörendes, komisches wie auch berührendes Gesamtkunstwerk. Seine Interpretation von Psycho. Eine ödipale Horrorshow-Ballade, blutrot-ästhetisiert wie bei Argento, traumwandlerisch-verkopft und trotzdem schlüssig-psychologisch analysiert. Versetzt mit einer morbiden beinah-Monty-Python-Note. Die Sehnsucht, die (Ehr)Furcht und das Unvermögen gegenüber der als göttlich wie fatalistisch dargestellten Weiblichkeit, sie nimmt radikale Formen auf allen Ebenen an. Erschütternd und bewegend, nachdenklich stimmend und parodistisch-überzeichnet, grausam und rührend. Die gesamte Emotionspallette nicht nur bedient, sondern kraftvoll ausgemalt mit einem Film. Der Zugeständnisse nur andeutet, um sie direkt danach (oder sogar mittendrin) zu widerrufen. Wunderbar.
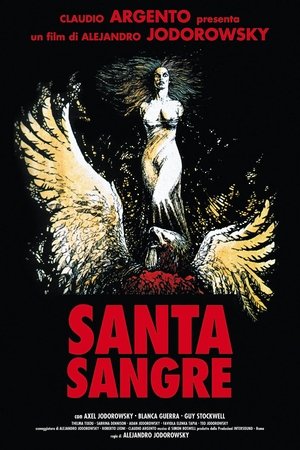 Trailer
Trailer
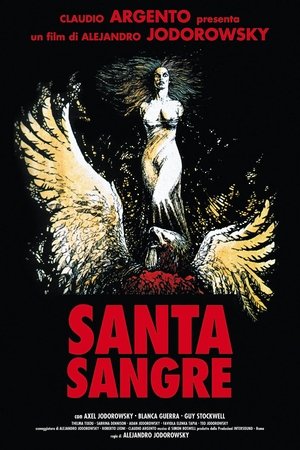



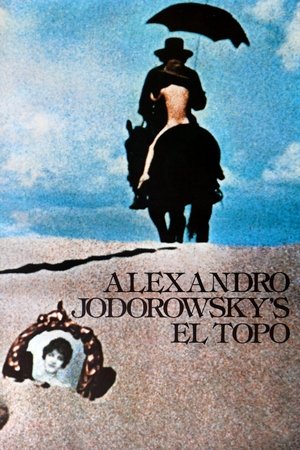
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!