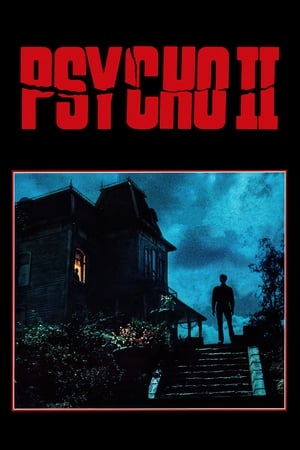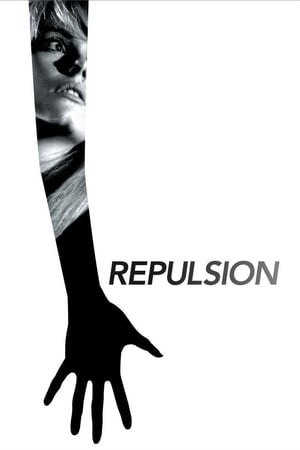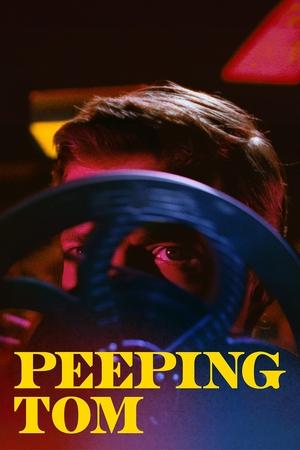Nachdem der aufwühlende Vorspann überstanden ist, in dem Saul Bass' alles zerschneidende Titelgestaltung und Bernard Herrmanns so dissonante wie unvergessliche musikalische Untermalung dem Zuschauer bereits auf unmissverständliche Art und Weis die innere Zerrissenheit vor Augen führt, die Psycho fortwährend durchziehen soll, schweben wir in ein Hotelzimmer, in dem sich Marion Crane (Janet Leigh, The Fog – Nebel des Grauens) und Sam Loomis (John Gavin, Mitternachtsspitzen) gerade zum Liebesspiel getroffen haben. Ihre Beziehung ist geheim, die Pläne, um eine gemeinsame Zukunft zu erschaffen, scheitern noch am Geld. Wir, die Außenstehenden vor der Leinwand oder Mattscheibe, werden von Regisseur Alfred Hitchcock (Vertigo – Aus dem Reich der Toten) geradewegs in die Rolle des Voyeurs verfrachtet, um nicht nur Zeuge ihres Schicksals, sondern auch Mitwissende und -Täter zu werden.
Die Kernmotive von Psycho scheinen bereits in den ersten fünf Minuten aufgezeigt zu werden: Es geht um gespaltene Seelen und das zum Zuschauen-Verdammt-Sein. Der Aspekt des Gespalten-Seins findet im Film mehrere Codierungen und beginnt mit Marion Crane, deren weiße Kleidung in ihrem ersten Auftritt von Unschuld spricht, um sie dann zur Diebin zu machen, die 40.000 Dollar unterschlägt – ein Verbrechen aus Liebe. Später, wenn der ikonische Norman Bates (Anthony Perkins, Der Prozess) die Bildfläche betritt, wird das Gespalten-Sein noch weiter ausgebaut: Es wird zum psychologischen Zustand. Bis dahin jedoch nimmt sich Psycho fast 40 Minuten Zeit und begleitet Marion Crane auf ihrer Flucht, wie sie von einem Verdacht schöpfenden Polizisten verfolgt wird, ihr Auto gegen einen neuen Wagen eintauscht, aufgrund von prasselndem Platzregen im Bates Motel Rast macht.
Diese Verkettung von Ereignissen, die Marion und Norman zusammenbringen, trägt selbstverständlich etwas Schicksalhaftes mit sich, allerdings unterstreicht es auch in ungeheurer Brillanz, dass Alfred HitchcockPsycho vordergründig in Situationen denkt und sein Hauptaugenmerk nicht auf die Handlung als Ganzes legt. Das erste Drittel der Geschichte, eben bis zu jenem Moment, in dem Marion unheilvollen Besuch unter der Moteldusche bekommt, stellt ein großes Ablenkungsmanöver dar, welches den Zuschauer zum Mitfiebern einlädt (wird sie es schaffen, mit dem Geld davonzukommen?), gleichwohl aber der Intention folgt, das Publikum aus seiner Komfortzone zu locken, indem über einen auffälligen langen Zeitraum die Spannungsschrauben in eine unerwartete Richtung gedreht werden. Alfred Hitchcock ist es in Psycho daran gelegen, emotionale Reaktionen auszulösen – und das gelingt ihm noch heute vortrefflich.
Sein ausgeklügeltes Spiel aus Sympathie und Antipathie, aus Furcht und Mitleid ist ein ungemein findiges, weil es jeden Akteur gleichermaßen betrifft und in einem Wechselbad der Gefühle abtauchen lässt; eben weil Alfred Hitchcock sich mittels genialer Inszenierungsstrategien und dem Mut zur erzählerischen Bruch- und Leerstelle viel Raum nehmen kann, bis die harten, schockierenden Fakten auf den Tisch gelegt werden. Vorerst ist da nur ein Muttersöhnchen, in dessen Hotel eine Frau brutal ums Leben gekommen ist. Ein Muttersöhnchen, welches unter der strengen Hand seiner Mutter leidet, dieser mütterlichen Härte (!) aber auch vollends ausgeliefert ist und sich abhängig von dieser zeigt. Die Vögel, die er seit Jahren ausstopft, präpariert und ausstellt, sind die stummen Zeugen dieser augenscheinlich ins Pathologische ausschlagenden Beziehung. Hysterie und Vernunft schmelzen dort, wo Menschen im Sumpf verschwinden.
Besonders eindrucksvoll ist die ausgiebige, minutiös komponierte und penibel geplante Gegenüberstellung von Mord und Tatortssäuberung. Der inszenatorische Aufwand, den Hitchcock betrieb, um Marion Crane in Stakkatoschnitten sterben zu lassen, investiert er daraufhin in Minuten, um Norman das Blut, die Leiche, die Hinweise entfernen zu lassen. Mag Psycho auch heute in der Ausdeutung seines „Antagonisten“ durchaus plakativ erscheinen, so ist das unfassbar wegweisende und immer noch nervenaufreibende Meisterwerk doch immer noch ein Angstmacher von nachhaltiger Wirkungsmacht. Langsam, aber gewissenhaft kriecht er unter die Haut des Zuschauers, gräbt Schächte in die Eingeweide, flammt sich in die Seele und stellt die unangenehme Frage, wovor wir uns eigentlich am meisten fürchten: Opfer oder Täter zu werden. Und was passiert, wenn wir beides zur gleichen Zeit sind?