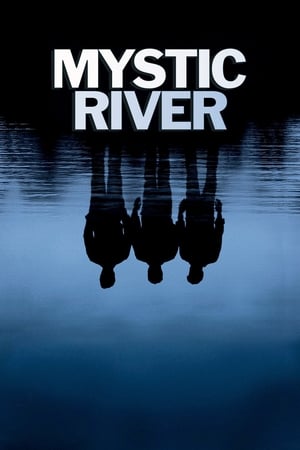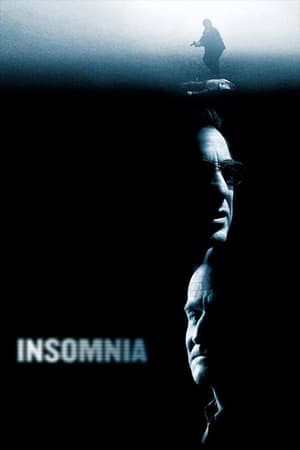Der irische Regisseur Lenny Abrahamson dürfte wenigen ein Begriff sein und selbst denen erst seit ungefähr einem Jahr. Sein Film über den exzentrischen Musiker-Alter-Egos Frank Sidebottom (mit Michael Fassbender als „Frank“) war ein kleiner Indie-Erfolg, bekam wohlwollende bis gute Kritiken und spielte sogar ein klein bisschen mehr Geld ein, als er kostete. Zudem konnte Lenny Abrahamson, der zuvor noch eine Nummer kleiner drehte („What Richard Did“), nun beweisen, dass er mit großen Namen gearbeitet hat. Nur ein Jahr später wurde er als Regisseur für die Adaption des Buches „Room“, das von der Irin Emma Donoghue als Reaktion auf den Fall um Josef Fritzl entstand. Der Österreicher hat seine eigene Tochter über Jahrzehnte hinweg in seinem Keller gefangen gehalten, mit ihr mehrere Kinder gezeugt und auch diese in dem Keller gehalten. Harter Tobak, der die künstlerischen Beteiligten hier zu Hochtouren bewegt.
Wichtig ist hierbei zunächst die klare Feststellung, dass der Film keineswegs eine Adaption der Geschehnisse in Österreich ist. „Raum“ schmückt sich nicht - wie so viele Filme es zweifelhafterweise tun - mit dem Banner „nach einer wahren Begebenheit“. Die Autorin der Vorlage sagte selbst, dass der Fall, der 2008 das Interesse der Medien auf sich zog, nur eine Art Startschuss war, dass es ihr jedoch nicht um eine Adaption ging. Und das ist gut so. Es beweist, dass es weder Abrahamson, noch Donoghue, die auch das Drehbuch verfasste, um einen Skandalerfolg ging, sie wollten nicht das Element des Schocks nutzen und mittels Sensationsgeilheit besonders viele Menschen abstoßen und damit anlocken. Sie wollten eine Geschichte erzählen, eine wichtige obendrein. Und das ist ihnen vorbildlich gelungen.
„Raum“ beginnt in selbigem. Paar Quadratmeter, nicht zu viel, gerade genug für ein Bett, einen Schrank, ein Klo, ein Waschbecken, eine Badewanne, einen Fernseher und einen winzigen Tisch. Stuhl 1 und Stuhl 2 lehnen an der Wand. Fenster gibt es nicht, Wände und die Decke sind komplett mit schallreduzierenden Flächen ausgestattet, einzig an der Decke gibt es ein kleines Fenster. Quadratisch ist die Aussicht in die Helligkeit und den blauen Himmel, der weiter entfernt zu sein scheint, als sonst. Der kleine Ausschnitt der Wirklichkeit, wenn man sich auf das quietschende Bett legt, könnte man ihn vielleicht mit einer ausgestreckten Kinderhand verdecken. Der kleine Jack, der zu Anfang des Films seinen fünften Geburtstag feiert, mit Kuchen, aber ohne Geschenk, weiß nicht so recht, was er von dem Fenster halten soll. Er weiß nur, dass das Leben in drei Drittel geteilt ist. Raum, All, Himmel. So wie er das sagt, ist es nur wahrscheinlich, dass er mit dem Himmel den Tod meint. Er ist fünf.
Der Film wird aus der Sicht von Jack erzählt, der Sohn von Ma, der während ihrer Gefangenschaft gezeugt wurde. Da war Ma schon zwei Jahre gefangen. Sie wohnen beide in dem Raum, der für Jack alles ist, sein Zuhause, sein Leben, die Welt, die Grenzen seines Verstandes. Ein kleines Zimmer, ebenso quadratisch wie das kleine Fenster im Dach, aus dem kein Schall je nach außen gelingen kann. Ganz zu Beginn ist die knackige Stille gar lauter als das Flüstern in der Dunkelheit von Ma. Ma gibt sich sichtlich Mühe, um ihrem Sohn etwas zu bieten, was einem Leben ähnelt. Mühe, die Jack gar nicht zu schätzen wissen kann, weil er seine Welt mit den Wänden und dem Dach endet, mit diesem Fenster, das mit der Zeit wie ein zynischer Witz scheint. Und mit dem Fernseher, den er klar als unecht erkennt. Monster sind echt, aber die Menschen im Fernseher nicht, die sind Scheiben. Wie der Himmel über ihm.
Man könnte wohl ewig so weitermachen, unzählige weitere Beispiele heranziehen, an denen die Klaustrophobie der Lebenssituation, die Hoffnungslosigkeit und die zutiefst bittere Tragik geschildert werden kann, in der Ma (Brie Larson aus „Short Term 12“, zu der wir später noch kommen) und Jack (mit toller Leistung: Jacob Tremblay, „Die Schlümpfe 2“) leben. Wobei leben das falsche Wort ist, zumindest für den Zuschauer und Ma. Wenn der alte Nick abends in den Raum kommt, um Ma zu vergewaltigen, wogegen sie sich schon gar nicht mehr wehrt, dann liegt Jack in dem Schrank, tut so als würde er schlafen, zählt aber leise die Sekunden, bis Nick wieder geht. Das hat etwas zutiefst abstoßendes und was herzzerreißendes und drückt in dem Moment dem Zuschauer ein Gewicht auf die Brust, von dem er sich nie wieder entledigen zu können scheint. Aber keine Sorge, Lenny Abrahamson weiß, was er hier tut, und setzt noch einen drauf. Und zwar auf die einzig richtige Weise; weniger explizit. Das wahre Grauen, grausamer als jedes Foto, ist der Verstand des Zuschauers.
Denn während das Publikum um die Lage weiß, sehen tut es von den Übergriffen wenig bis gar nichts. Es leidet nur mit Ma, wenn Jack und sie anscheinend ritualisiert in die Abzugsschächte schreien, um potenzielle Nachbarn auf sich aufmerksam zu machen. Für Jack ist das ein Spiel und Ma spielt mit, obwohl sie weiß, dass es hoffnungslos ist. Vieles ist für Jack ein Spiel, alles eigentlich, so auch der weiße Dampf, der sein Atem ist, weil Nick die Heizungen abgestellt hat und es eiskalt im Raum wird. „Ma, ich bin ein Drache.“ sagt er stolz und atmet sie an. Er ist zufrieden in seinem Zuhause, es ist schließlich alles, was er je kannte, kennt und, geht es nach Nick, kennen sollte. Er ist zufrieden und das ist vielleicht mit eine der schlimmsten Dinge für Ma. Wir sehen sie, wie sie sich den Mund zuhält, damit ihr Sohn sie nicht beim Weinen hört. Es sind Szenen wie diese, die zu dem schmerzvollsten gehören, was in der nächsten Zeit seinen Weg auf die Leinwand finden wird.
Das, was den Film so überragend macht, ist die Tatsache, dass er sich immer nur noch zu steigern scheint. Der Streifen ist eine perfekte Symbiose aus Drama, Tragödie und den tastenden Elementen des Coming-of-Age-Films und überzeugt vor allem durch die Regie von Abrahamson, der ein unfehlbares Händchen beweist, wenn es um Timing und Schauspielführung geht. Die zwei Stunden Film sind äußerst kurzweilig und spielen die Emotionen des Zuschauers so gekonnt rauf und runter, dass man zeitweise gar nicht weiß, wie einem geschieht. Das liegt aber auch an Brie Larson, die hier mit Abstand die beste Leistung ihrer Karriere abliefert (um das zu wissen, muss man nicht mal all ihre Filme kennen) und mindestens eine Nominierung für den Oscar bekommen. Was Larson hier liefert ist schlicht nicht mehr als erstklassig zu bezeichnen, es liegt noch darüber. Eine Leistung, die den Autoren dieser Kritik an den Rande seines Wortschatzes bringt. Toll. Sagenhaft. Ganz große Klasse.