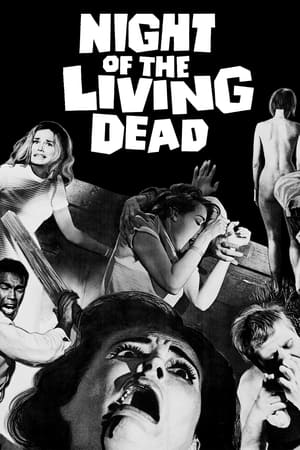„Es tut mir leid, wegen der Mauer, aber sie wissen sicher, wie das jetzt ist.“
Wenn kulturelle Wahrzeichen in Flammen aufgehen, ist der Untergang der Zivilisation beinahe beschlossene Sache. Diese Bilder, die vielmehr in der Funktion von Trägermedien in Erscheinung treten, sind uns vor allem aus dem apokalyptischen Horrorfilm oder dem gigantomanischen Katastrophenfilm bestens bekannt. Ein Roland Emmerich (Independence Day) hat immer schon eine ausgeprägte (Schaden-)Freude daran offenbart, primär amerikanische, aber auch internationale Sehenswürdigkeit in Schutt und Asche zu legen. Man muss diese Sequenzen als Gradmesser für das vorherrschende Bedrohungsszenario verstehen, wenn Mutter Natur in brachialer Gewalt all das für sich erobert, was über Jahrtausende als Denkmal für die menschliche Willenskraft in den Boden gestampft war. Und genau nach diesem Prinzip funktioniert auch der Zombie- respektive Infiziertenfilm: Wenn unsere Realität angreifbar gemacht wird, beginnen wir vor der Leinwand zu zweifeln.
Damit ist freilich nun nicht nur gemeint, den Eiffelturm, die Freiheitsstatur, den Berliner Fernsehturm in sich zusammenstürzen zu lassen, man kann diesen Aspekt auch auf die psychologische Komponente übertragen: In einer Extremsituation nämlich kommt das wahre Naturell des Menschen zum Vorschein. Rammbock, dieser unscheinbare Beitrag zum Kleinen Fernsehspiel, richtet seinen Blick speziell darauf, wie der Mensch handelt, wenn er davon Zeuge wird, dass die Zeit seines Leben anerzogenen zivilisierten Fassaden um ihn herum einstürzen. Michael (Michael Fuith, Michael) ist Österreicher und macht sich auf den Weg in die deutsche Hauptstadt, um die Liebe seiner Gabi (Anka Graczyk) zurückzugewinnen. Angekommen in Berlin, irgendwo in einem Hinterhof von Kreuzberg, was nicht der Film selbst, sondern die Produktionsnotizen hergeben, findet Michael nicht sein Herzblatt, sondern alsbald das Chaos vor.
Menschen wüten in Scharen durch die Straßen, stürmen von Wohnung zu Wohnung, allein angetrieben von ihrem Fresstrieb. Es dauert kaum mehr als 10 Minuten bis, bis Regisseur Marvin Kren (Blutgletscher) den gemütlichen Ösi mit den apokalyptischen Verhältnissen in Berührung bringt und ihn, zusammen mit einigen wenigen Gefährten, um das Überleben kämpfen lässt. Krens Affinität für den klassischen Horrorfilm ist in jedem Frame dieser Fernsehproduktion erkennbar, allerdings ist es dem Filmemacher nicht daran gelegen, offensiv über das Gemetzel Zugang zum Zombie-Reißer zu finden. Vielmehr ist es Rammbock daran gelegen, der psychischen Belastung und körperlichen Anspannung Aufmerksamkeit zu spenden und das Geschehen über die psychologischen Beklemmungen abzutasten. In seinen stärksten Momenten gelingt es Kren dabei, das Alltägliche auf den Prüfstand zu stellen und in Zeiten der Katastrophe eine neue Normalität zu etablieren.
Ganz selbstverständlich greift Michael eines Morgens in den Kaninchenkäfig und isst den Vierbeinern die Knabberstangen weg. Der neue Alltag fordert eine neue Logik ein, ein neues Handeln, ein neues Reflektieren. Und dieser neue Alltag wird genau dadurch so bedrückend, weil die Seuche sich als namenloses Übel über Berlin (oder die Welt) ausgebreitet hat. Mag Rammbock sich in seinem epigonalen Gestus auch nicht aus dem Schatten der großen Vorbilder bewegen und gleichwohl durch den Rahmen des TV-Films ein Stück weit in seinen Möglichkeiten (finanziell, aber auch technisch) eingeengt sein, so ist die knapp über 60-minütige Laufzeit doch ein Beispiel dafür, dass der deutsche Genre-Film durchaus existiert. Das Klima der Tristesse und Ausweglosigkeit jedenfalls weiß Marvin Kren gekonnt heraufzubeschwören, nicht zuletzt, weil seine Regie die richtigen Schwerpunkte setzt und Rammbock als Stimmungsbild einer sich selbst zerfleischenden Gesellschaft definiert.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org