Der Auftakt zu Oliver Stones Vietnam-Trilogie war sein großer Durchbruch, heimste seinerzeit 4 Oscars ein, u.a. als bester Film und für Stone als Regisseur. Während es mit Stones Karriere in den letzten Jahren ähnlich steil bergab ging wie mit denen einiger prominenten Kollegen (Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Dario Argento, John McTiernan, Renny Harlin…um nur einige zu nennen), galt er damals noch als stets kritischer, offensiv-anprangernder Filmemacher. Praktisch alle seine Werke bis 1995 thematisierten direkt aktuelle oder historische Missstände und Fehlverhalten von Gesellschaft und Regierung seines Heimatlandes, teilweise auch mit dem radikalen Holzhammer, was gleichzeitig zu großem Lob der Allgemeinheit, aber auch Anfeindungen von Seiten patriotisch-konservativer Lager führte. Speziell Vietnam hatte es Stone angetan, diente er doch selbst an der Front. Platoon war persönliche Vergangenheitsbewältigung, die Figur des jungen Rekruten Taylor (in seiner ersten großen und bis heute besten Rolle: Charlie Sheen, Wall Street) ist als sein Alter Ego anzusehen.
Rein aufgrund idealistischer Gründe meldet sich der aus gutem Hause stammende Chris Taylor 1967 freiwillig zum Kampfeinsatz. Er will seinem Land dienen, seinen Beitrag für die gute Sache leisten. Die Desillusionierung lässt nicht lange auf sich warten. Schnell wird ihm bewusst, dass er einem fatalen Irrglauben unterlegen ist. Der Krieg in Vietnam ist kein Kampf für die gute Sache, er ist die Hölle auf Erden und er nur Frischfleisch für den Dschungel. Niemand kämpft hier für Freiheit, Menschenrechte oder sein Land, jeder kämpft ums nackte Überleben; zählt die Tage rückwärts, wenn er hoffentlich wieder mit heiler Haut den Hexenkessel für immer hinter sich lassen kann. Die angeblich übermächtige US-Armee ist auf feindlichem Boden trotz zahlenmäßiger und materieller Überlegenheit nur ein unkoordinierter Haufen, dem taktisch und territorial geschulten Feind hoffnungslos unterlegen. Schon wenige Wochen können gestandene Männer brechen, das Schlimmste im Menschen wecken, bis sie nur noch wilde Tiere sind.
Im Laufe seiner Dienstzeit reißen interne Grabenkämpfe eine tiefe Kluft durch sein Platoon, spaltet es in zwei rivalisierende Lager. Ausgelöst durch den Konflikt zwischen der skrupellosen, hasserfüllten Kampfmaschine Lieutenant Barnes (Tom Berenger, Inception, mit einer erschreckend-grandiosen Leistung) und dem gutherzigen Sergeant Elias (Willem Dafoe, Spider-Man , der hier eine der wohl meistparodierten Szenen der Filmgechichte hat), der sich trotz des ganzen Elends seine Menschlichkeit bewahrt hat. Taylor, der anfangs noch von Barnes‘ imponierenden Auftreten fasziniert war, schlägt sich nach dessen schockierenden Amoklaufs in einem kleinen Dorf auf die Seite von Elias. Von nun an ist die Einheit nicht mehr als solche zu bezeichnen, der Feind lauert nicht mehr ausschließlich unsichtbar im Dickicht, er steht direkt neben einem.
Oliver Stone setzt weder auf eine großartig ausgefeilte Geschichte, irgendeiner Form von Subtilität oder gehobenen, künstlerischen Anspruch, sein Werk bezieht seine Klasse durch seine reine Authentizität. Seine persönliche Teilnahme an diesem Krieg ist unübersehbar. Stone zeigt das, was er selbst erlebt hat, manifestiert nur in den klar definierten Gut-und-Böse-Figuren von Barnes und Elias die perverse Negation jeglicher Normen, Werte, Moral. Wie man es von ihm auch später gewohnt war, nicht durch die Blume, sondern direkt in die vernarbte, traumatisierte Fresse der USA. Ein schier endloser, im Endeffekt total unnötiger Krieg, der tausende von Leben opferte und wahrscheinlich ebenso viele Seelen zusätzlich zerstörte. Platoon schildert unmissverständlich, ungefiltert die Sinnlosigkeit dieses Irrsinns, die Hilflosigkeit der Beteiligten und die Folgen, wenn Menschen nicht mehr trennen können, was gut oder böse, richtig oder falsch noch bedeutet.
Atmosphärisch so dicht wie das vernebelte, undurchsichtige Grün des Schlachtfeldes, in einnehmenden Bildern exzellent fotografiert und durch die Bank hervorragend gespielt. Allein bei der Auswahl der Nebenrollen bewies man ein erstaunliches Händchen, ein halbes Dutzend der hier teilweise nur kurz durchs Bild huschenden Darsteller sollte noch eine mehr oder weniger beachtliche Karriere machen (Forest Whitaker, Johnny Depp, John C. McGinley, Tony Todd, Keith David, Kevin Dillon). Kritisieren könnte man gelegentlich nicht zu leugnenden Pathos, auch bei der sonst tollen Musikuntermalung, nur ernsthaft stören tut das kaum. Schließlich ist dies wohl auch der logischerweise nicht distanzierten Sichtweise des Regisseurs und seinem grundsätzlichen Anliegen wie Stil geschuldet, bloß nicht irgendwas im Unklaren zu lassen. Hier nervt das nicht, es unterstreicht nur die Priorität, das Herzblut von Stone für dieses Projekt.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org












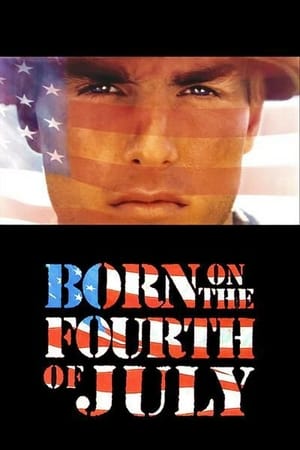
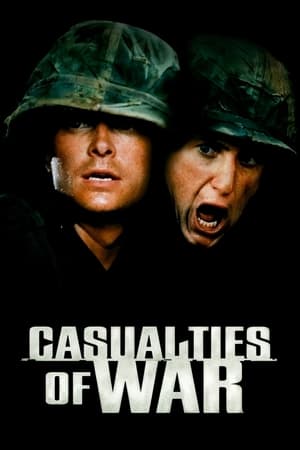
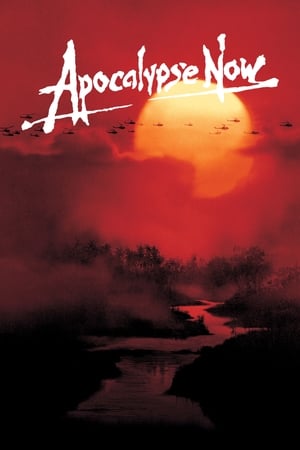
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!