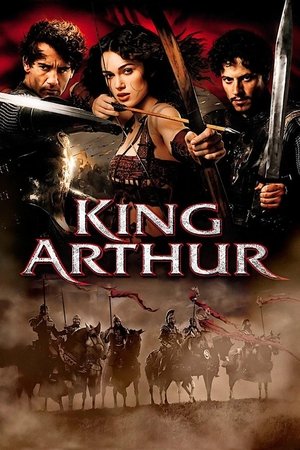Es ist eine der entscheidenden und nachhaltigen Szenen in Outlaw King: Die Niederlage, welche der schottische Freiheitskämpfer William Wallace in seinen Schlachten gegen die englische Unterdrückung mit einem äußerst bestialischen Tode bezahlen musste, erfährt hier eine bedrückende und gleichermaßen klare Begründung. Wallace nämlich war mehr Idee denn Mensch, zwischen ihm und der Revolution hat sich eine inbrünstige Liebe entfacht, doch alle Liebesgeschichten haben einen schrecklichen Feind: Die Zeit. Was von Wallace, dem Menschen, übrig geblieben ist, behält Outlaw King seinem Publikum ebenfalls nicht vor: Die vom Torso getrennten Extremitäten seiner Person werden an öffentlichen Plätzen zur Schau gestellt - und damit wurde auch Wallace, die Idee, in ihre Einzelteile zerschlagen. Wenn es beliebt, dann darf man diese Impressionen natürlich auch als Kommentar auf Mel Gibsons Braveheart verstehen.
David Mackenzie (Mauern der Gewalt), der sich erst durch Filme wie Young Adam oder Hallam Foe einen Namen im britischen Independent-Kino zu machen wusste, um dann durch seinen intensiven Neo-Western Hell or High Water zum Oscar-Kandidaten zu avancieren, ist es mit Outlaw King jedoch nicht daran gelegen, Wiedergutmachung für die historische Klitterung zu tätigen, die sich Mel Gibson in seinem mehrfach ausgezeichneten Schlachten-Epos aus dem Jahre 1995 geleistet hat. Stattdessen besitzt MacKenzie den Anspruch, die Jahre der Qualen, Unterjochung und des Terrors, die Schottland auf sich nehmen musste, um sein Königreich wieder in die Unabhängigkeit zu führen, an geschichtlichen Tatsachen orientieren zu lassen: Wir steigen im Jahre 1304 ein, in dem König Edward die Macht an sich riß, Schottland besetzte und alle Wiederstände, die William Wallace anführte, zerschlug.
Acht Jahre der Rebellion, acht Jahre des Scheiterns, für Robert the Bruce (Chris Pine, Star Trek Into Darkness) auch acht Jahre des Ausharrens, des Ertragens, um sich dann, nachdem sich sein Vater mit dem englischen Adelshaus verbrüderte und seinem Sohn eine Ehe mit Elizabeth (Florence Pugh, Lady Macbeth) aufzwängte, selbst zum Anführer der Auflehnung zu erklären. Was sehr schnell an der Inszenierung von Outlaw King auffällt, ist, dass Mackenzie den pathetischen Urschrei, den Mel Gibson in Braveheart noch durch die Lichtspielhäuser schallen ließ, auf ein Minimum reduziert. Robert the Bruce ist nicht heroisch im eigentlichen Sinne; er tritt sicherlich für sein Land ein, allerdings auch aus dem Grund, weil er sich selber nicht mehr dem Duckmäusertum hingeben möchte, zu dem ihm die Engländer bedrängt haben.
Robert möchte kein Märtyrer werden, es möchte die Dinge endlich wieder ins Reine bringen, entweder als Bestie oder als Waffenbruder, der auch im Angesicht seiner Feinde imstande ist, Gnade walten zu lassen. Mag der außerordentlich gutaussehende Chris Pine auch nicht die charismatische Strahlkraft eines Mel Gibson besitzen, seine Interpretation eines zurückgenommenen Quasi-Rädelsführer aber ist für all diejenigen ein Geschenk, die sich an den großen, überbordenden Gesten von Mad Mel immer schon gestoßen haben. Und genau das lässt sich als programmatischer Umstand auf die gesamte Produktion übertragen: Outlaw King möchte nicht ausladend sein; er möchte sich nicht in Theatralik wälzen. David Mackenzie erzählt seinen Historienfilm hingegen mit besonnener Nüchternheit, lässt die Emotionen nur ganz selten Überhand nehmen und scheint vor allem Interesse daran zu haben, ein stimmungsvolles Peroid Picture zu erschaffen.
Als reines, auf handwerkliche Komponenten setzendes Ausstattungskino ist Outlaw King dann auch ein wahres Erlebnis: Der Film begrüßt seine Zuschauer, nachdem einige Texttafeln über den Bildschirm gewandert sind, mit einer fast zehnminütigen Plansequenz, die diese wie neugierige Beobachter durch die historischen Kulissen wandern lässt. Ohnehin ist der The Hurt Locker-Kameramann Barry Ackroyd hier der eigentliche Star, seine elaborierten Kamerafahrten, beobachtend, behände, immerzu dyanmisch und das Geschehen strukturierend, geben dem Film seinen Takt, seinen Rhythmus – und machen ihn vor allem zur mitreißenden Augenweide, was sowohl die erhabenen Landschaftspanoramen der schottische Highlands wie auch die bisweilen ungemein brutalen, offenkundig von HBOs Game of Thrones beeinflussten Schlachtensequenzen betrifft, in dem die Gesichter der grimmigen Kriegervisagen im unübersichtlichen Getümmel abwechselnd mit Schichten aus Blut und Schlamm bedeckt werden.
Und Game of Thrones ist ohnehin ein gutes Stichwort, bemüht auch Outlaw King – natürlich zuvorderst aufgrund seiner geschichtlichen Vorlage – die gleichen Themen, die auch das serielle Erfolgsformat beackert: Es geht um Herrschaft und Unterwerfung, machtstrategische Ränke, Verrat, Intrigen und um die Verpflichtung sich und dem Volk gegenüber, den knechtenden Status quo nicht weiter zu akzeptieren. Irgendwann ist sich auch Robert the Bruce sicher, dass es Zeit wird, jedwede Ritterlichkeit abzulegen und wie Wölfe gegen die Engländer zu Felde zu ziehen. Wirklich kraftvoll mag der dennoch tadellos inszeniert und vor allem exzellent fotografierte Outlaw King dabei nur selten sein, dafür präsentiert er sich im Umgang mit der epischen Topoi zu bodenständig, allerdings ist er dafür etwas ganz anderes: Erhaben. In sich geschlossen, fernab jeder Penetranz in der Ausformulierung seiner Wertevorstellung und bisweilen fast schon sympathisch zurückgenommen.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org