Diese Besprechung basiert auf dem 14-minütig längeren Director's Cut, der der jugendfreien Kinofassung im Endeffekt allerdings nur in seinen Gewaltsequenzen voraus ist.
Was hat man sich nur dabei gedacht, dem renommierten Sagensystem rund um die Matière de Bretagne eine zwanghaft authentische Garderobe überzustülpen? Die Legende um König Artus, die Ritter der Tafelrunde, Excalibur und Camelot, sollte sich doch fortwährend als eine offenkundig fiktive Sagengestalt verstehen lassen, die einzig und allein über die Lust am Fabulieren vollends entfaltet werden kann. Welchen Sinn muss es also haben, die Artuslegende historisch zu verbürgen? Keinen. Überhaupt keinen. Dies bezeugt King Arthur, inszeniert von Antoine Fuqua (The Equalizer) und produziert von Jerry Bruckheimer (Fluch der Karibik), auf äußerst gravierende Art und Weise, bremst sich das Action-Abenteuer in seiner eskapistischen Eventualität doch durch seinen fadenscheinigen Anspruch auf Glaubwürdigkeit permanent selbst aus.
Antoine Fuqua ist ein äußerst kompetenter Handwerker, selten mehr (Training Day), aber niemals weniger. Für einen Stoff wie King Arthur aber scheint er der grundlegend falsche Mann gewesen zu sein, fehlt ihm doch das rechte Talent für das Fantasieren und Ausmalen. King Arthur wäre in den Händen eines Regisseurs, der sich für die Entblättterung mythischer Heldenmäre interessieren würde, wohl eine unbefleckte Leinwand grenzenloser Möglichkeiten. Fuqua hingegen leitet King Arthur in der Linie über martialische Posen her: Ständig sieht man Arthur (Clive Owen, Sin City) und seine treuen Vasallen (darunter Mads Mikkelsen als Tristan oder Ion Gruffudd als Lancelot), wie sie mit aufgerissenen Mäulern ihr Schwert dem Himmel entgegenstrecken, ebenso wie das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald.
Als Zuschauer muss man durchweg mit diesen drohenden Kriegsgebärden vorliebnehmen, wenn es um die Mittel geht, mit denen King Arthur die Tapferkeit der Figuren attestiert – eine echte Unterforderung für die involvierten Charakter-Darsteller also. Das Hauptproblem liegt eben, wie erwähnt, in der paradoxen Ambition, Authentizität ins Sujet fließen zu lassen. Paradox, weil Historiker bis heute nicht herausfinden konnten, ob es König Artus wirklich gegeben hat, was King Arthur in seinem Bestreben, sagen wir, reichlich überheblich erscheinen lässt. So wird kurzerhand ein Konflikt herbeigesponnen, der im finalen Schlachtengetümmel zwischen den britannisch-sarmatischen Special-Force-Reitern im Namen des römischen Imperiums und den marodieren Angelsachsen, die es in dieser Form nie gegeben hat, seinen brutalen Höhepunkt findet.
Dramaturgisch gestaltet sich King Arthur folgerichtig ähnlich einfältig, wie sämtliche andere Genre-Vertreter, und arbeitet sich nach altbewährter Methodik bis zum alles entscheidenden Gefecht vor, untermalt von Hans Zimmers pathetisch-aufgeblähtem Orchester und einem penetranten Color Grading, welches die nebelumflorten Bilder so richtig matschig erscheinen lässt: Dark & Gritty ist eben en vogue, was auch das ungepflegte Erscheinungsbild der heroischen Mannen begreiflich macht. Immerhin gelingt es Fuqua hier und da, seine inszenatorischen Fähigkeiten aufblitzen zu lassen, beispielsweise, wenn sich Arthur und Cynric (Til Schweiger, Honig im Kopf) zum ersten Mal auf einem zugefrorenen See Auge um Auge gegenüberstehen. Aber jene an einer Hand abzählbaren Set Pieces retten diesen düsteren Feldzug nicht vor reichlich Leerlauf.
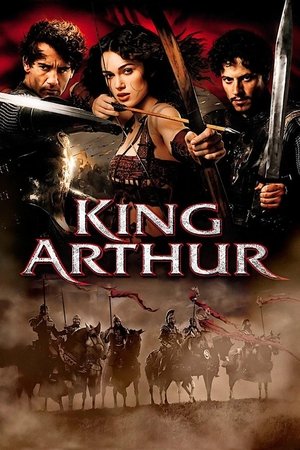 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org
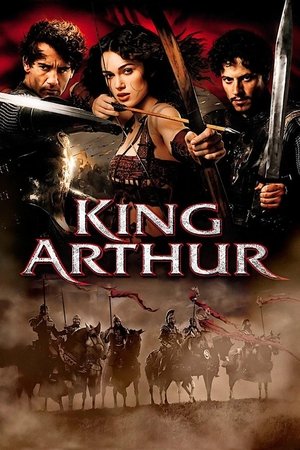




















Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!