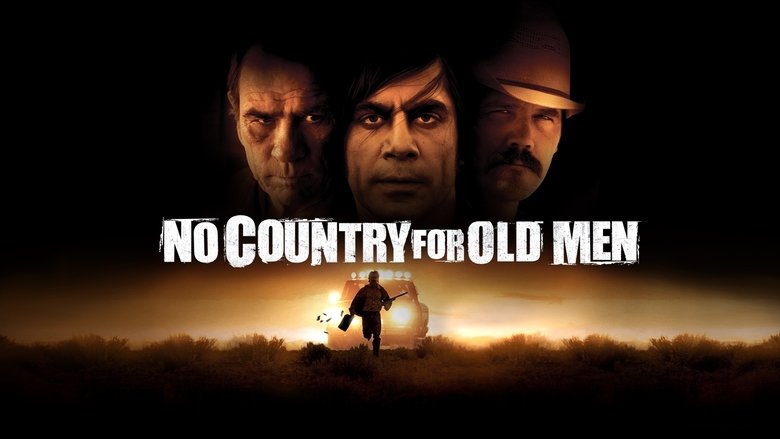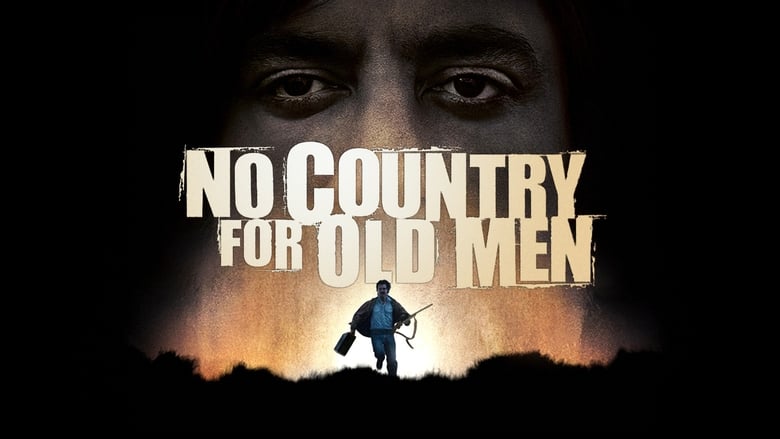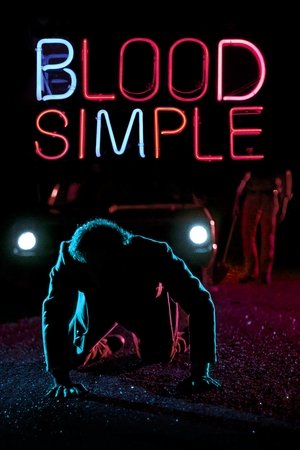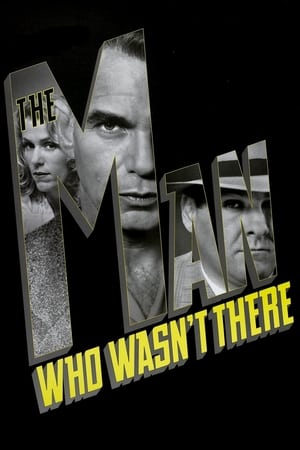Fast hätte man Mitte des neuen Jahrtausends annehmen können, dass Ethan & Joel Coen in Besagtem noch nicht so richtig angekommen waren. Sie eröffneten gewohnt stark mit O Brother, Where Art Thou? – Eine Mississippi Odyssee und The Man Who Wasn’t There, aber dann schien es beinah so, als wären sie ein wenig satt geworden. Die Auftragsarbeiten Ein (un)möglicher Härtefall und das Remake The Ladykillers waren zwar nette Unterhaltung und trugen sogar unverkennbar die Handschrift der exzentrisch-brillanten Gebrüder, mehr aber keinesfalls. No Country for Old Men – in ihrer zum damaligen Zeitpunkt bereits mehr als dreißigjährigen Karriere die erste Romanadaption – war somit nicht nur so was wie ein Comeback: Es war eine Rückbesinnung; die Rückkehr zu ihren Wurzeln. Diese entsprangen 1984 im staubigen, blutgetränkt-texanischen Wüstensand. Seit ihrem Debütfilm Blood Simple waren die Brüder nie wieder so nihilistisch, bösartig und spaßbefreit konsequent. Fargo war 1996 so was wie ein Zwischenschritt. Griff die zynische Blood & Greed-Thematik wieder auf, veredelte sie jedoch mit dem skurrilen Humor einer herzlichen Provinz-Posse, was die Coens in der Zwischenzeit zu einem Markenzeichen gemacht hatten. No Country for Old Men streicht diesen weitestgehend wieder von der Karte. Ähnlich wie bei ihrem Beginn zuckt maximal ein knurrig-böses Lächeln mal durch das Gesicht, ansonsten ist das nicht nur kein Ort für alte Männer, sondern auch keiner für Spaßvögel und Blümchenpflücker.
„What’s the most you’ve ever lost in a coin toss?“
Während eines Jagdausflugs scheint der knochentrockene Vietnamveteran Llewelyn Moss (Josh Brolin, Avengers: Endgame) unverhofft das große Los gezogen zu haben. Er entdeckt die offenbar noch recht frischen Überreste eines sehr schiefgelaufenen Drogendeals. Mitten in der Wüste stehen ein paar Autos, geschmückt mit von Kugeln perforierten Leichen. Selbst der Hund hat drei Schüsse gefangen. Neben einem vor sich hin krepierenden, dehydrierten Mexikaner findet er eine Ladefläche voller Drogen vor, aber da er Eins und Eins zusammenzählen kann, ist für ihn viel spannender, wohin sich das andere Ende des Regenbogens verkrümelt hat. Denn so eine Menge an Stoff erfordert einen entsprechenden Gegenwert, dessen Abwesenheit das Blutbad erklären würde. Moss findet die Kohle und ist sich sehr wohl bewusst, dass er sich damit sofort aus dem Staub machen sollte. Der einzige Anflug von Ethik während der knapp 2 Stunden wird ihm dabei zum Verhängnis. Denn als er zum Tatort zurückkehrt um den vorher zurückgelassenen Überlebenden doch noch mit Wasser zu versorgen, läuft er seinen zukünftigen Verfolgern direkt in die Arme. Hinterlässt Spuren, an die sich der diabolische Auftragsmörder Anton Chigurh (gespenstisch: Javier Bardem, Das Meer in mir) in der Folge heftet. Eigentlich vom Drogenkartell engagiert um deren Eigentum zurückzuholen, handelt er schnell unerklärlich auf eigene Rechnung und tötet einfach alles, was ihm in die Quere kommt. Außer, die Münze meint es gut mit einem.
Auch wenn es aufgrund des unfassbar hohen Qualitätsstatus der Coens gewagt klingen mag: No Country für Old Men ist ihr bester Film. Bei Meisterwerk gegen Meisterwerk sind das immer nur Wimperschläge und natürlich auch von subjektiven Eindrücken nicht zu isolieren, analytisch betrachtet bleibt aber nur dieses Resultat übrig. Was sie einst groß machte, praktisch wie Phönix aus der Asche in höchste Sphären aufschwang, kehrt hier in nahezu makelloser Perfektion zurück zu seinem Ursprung. Auch wenn das hier hauptsächlich der Blood Simple von nun etablierten Profis und gereiften Genies ist, nicht um ganz dezente Anspielungen auf ihre anderen Werke verlegen. In erste Linie natürlich auf Fargo, denn der vermeidliche Hauptcharakter Tom Bell (Tommy Lee Jones, Ad Astra – Zu den Sternen) taucht – wie einst auch Frances McDormand – erst nach gut einer halben Stunde auf, um dem bis dahin getriebenen Irrsinn Einhalt zu gebieten. Der deutliche Unterschied: Er wird es nicht schaffen. Regelte die hochschwangere, sympathisch-entspannte Dorfpolizistin den Job quasi im Vorbeigehen, scheitert der grummelige, weltendfremdete Sherriff mit Ansage. Ist nie auf der Höhe des Geschehens, immer den entscheidenden Schritt zu spät, was sich besonders am Ende dramatisch niederschlägt. Resigniert muss er das selbst als Résumé hinnehmen, was aber ideal in den Tonfall dieses pechschwarzen Ungetüms passt.
Früher war alles besser, heute versteht man die Welt nicht mehr. Sodom und Gomorra. Das ein Film mit dieser Message 2007 im Jahr 1980 angesiedelt ist, passt perfekt zum unglaublich grimmigen Grundton der Coens. Es wird nur noch schlimmer, ob man es glauben kann oder nicht. Dieses spezielle Zeitdokument mit eigentlich zeitlosem Kontext ist besonders geprägt durch inszenatorische Perfektion. Als hätten sie immer auf genau diesen High Noon hingearbeitet. Wortkarger war (und da schließt sich abermals der Kreis) höchstens Blood Simple, dafür gewinnt jeder Dialog umso mehr an Bedeutung. Und die Herren verstehen es dann eben, diese besonderen Momente nicht beliebig zu vergeuden. Die große Kunst von No Country for Old Men ist das Schweigen. Das Präsentieren. Das Erschließen von Zusammenhängen, Konsequenzen und den daraus folgenden, logischen Resultaten. Das Erzählen einer Geschichte, basierend auf den Methoden des Mediums. Das klingt so selbstverständlich, aber wenn man sich das Reultat ansieht versteht man wohl (hoffentlich), warum genau das nur ein Film so bieten kann und wie beinah fahrlässig es oftmals ist, dies nicht zu nutzen bzw. darauf zu vertrauen.