„Weißt Du, was das Schöne hier ist? Dass die Menschen keine Schatten haben.“
Ein pompöses Orchester öffnet die Pforten zur Welt des Ludwig Il. (O.W. Fischer, Onkel Toms Hütte). Es ist eine Welt, in der der Wirklichkeit eine untergeordnete Rolle zugeschrieben werden soll; in der das schwelende Arrangement von Instrumenten keinen Schwermut, sondern Schönheit verbreiten soll. Ludwig II., der am 10. März 1864 im Alter von nur 18 Jahren den Thron bestieg und zum König von Bayern ernannt wurde, sah sich vor allem den schönen Künsten zugewandt, um an genau dieser Leidenschaft zu zerbrechen. Seine Liebe für die Kompositionen Richard Wagners ist wohl das beste Beispiel dafür, wie allergisch Ludwig auf die Realität reagierte, denn auch wenn ihn die Musik Wagners in die höchsten Höhen geleitete, musste er mit Erschrecken feststellen, dass sich hinter der feingeistigen Fassade ein antisemitischer Opportunist befindet.
Obgleich es in diversen historischen Überlieferung heißt, Ludwig II. hätte sich nicht um das politische Geschehen geschert, war der König in den ersten Jahren seiner royalen Herrschaft doch mit tugendreicher Gewissenhaftigkeit darum bemüht, den Anschluss an die Gegebenheiten einer intakten Staatsführung zu wahren. Ob ihm die Umstände dieser auch wirklich am Herzen lagen, steht auf einem anderen Platt geschrieben. Würde man sich nach der Sichtung von Helmut Käutners Ludwig II. - Glanz und Elend eines Königs aus dem Jahre 1955 eine Antwort auf diese Frage erlauben, so würde diese wohl auf eine Negation hinauslaufen. Der von O.W. Fischer gespielte Märchenkönig ist ein Bonvivant. Ein an die klassische Romantik verlorengegangener Träumer, der es zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, seinen Träumen ein Zuhause zu schenken.
Und genau diesem Träumer errichtet Käutner ein aufwändiges Denkmal. Ludwig II. versuchte es, sich durch den übermäßigen Prunk eine Art in Pracht und Pomp ersaufenden Schutzkokon zu errichten, um mit der Realität nicht auf Tuchfühlung zu gehen. Seine über 13 Millionen Mark verschlingende Manie, Schlösser von sagenhafter Anmut zu errichten, lässt sich natürlich auch als psychologische Reaktion dahingehend werten, sich weitergehend von der Wirklichkeit abzunabeln, um sich in seiner eigenen Idealvorstellung des Lebens zu verkapseln. Ludwig, der den Menschen Frieden bringen wollte, hat schnell realisieren müssen, dass Macht eine Waffe ist, die man letztlich auch gegen sich selbst richten kann, wenn man sich ihrer Gefahr nicht bewusst wird. Daher scheint es fast nur logisch zu sein, dass sich die Regierungsperiode Ludwigs dadurch auszeichnete, immer einen Schritt weiter zurück zu gehen. So lange, bis ihm eine paranoide Geisteskrankheit attestiert wurde.
Selbst wenn es nahezu untragbar erscheint, Helmut Käutners gelungene Version mit der meisterhaften Umsetzung des überlebensgroßen Luchino Visconti in Relation zu setzen, so sind beide Filme in ihrem Kern doch eine entzaubernde Tragödie über die Unmöglichkeit, der erschlagenden Konsequenz der Realität zu entkommen. Ludwigs körperlicher wie seelischer Verfall ist unausweichlich. Die Welt, vor der er sich verstecken wollte, zu der er aber schlicht und ergreifend zugehörig sein sollte, war Menschen wie Otto von Bismarck vorbestimmt, die mit Reichtum keine kulturellen Monumente erschaffen wollten, sondern eine einzigartige Kriegsmacht aus dem Boden stampfen. Für Träume war in dieser Welt kein Platz, stattdessen muss Ludwig II. sie mit ins Grab nehmen, dem mythischen Raum unterhalb unserer irdischen Existenz, in dem es möglich sein könnte, den Mond anzubeten, ohne dafür verdammt zu werden.





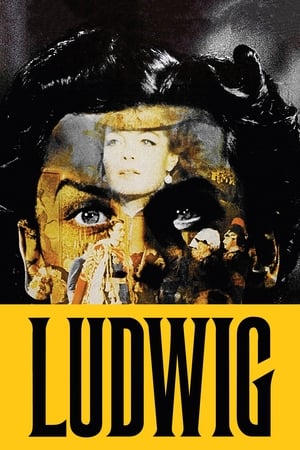
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!