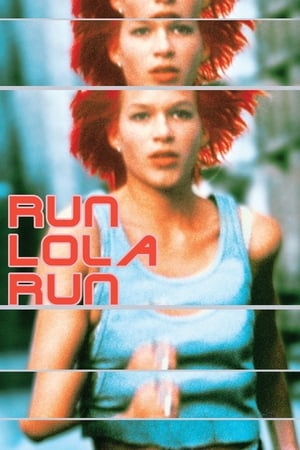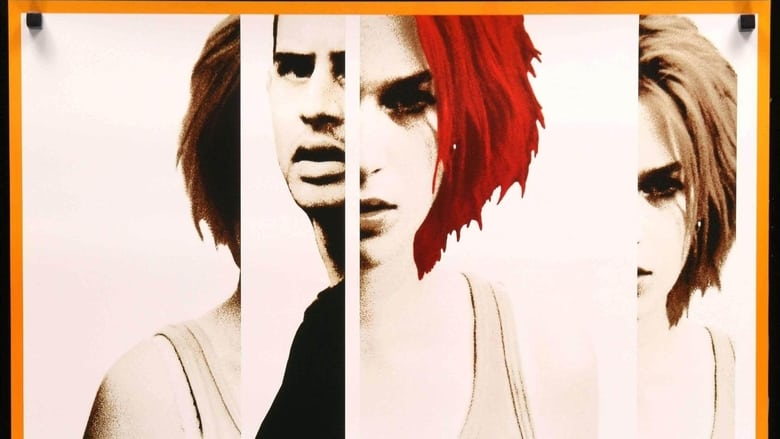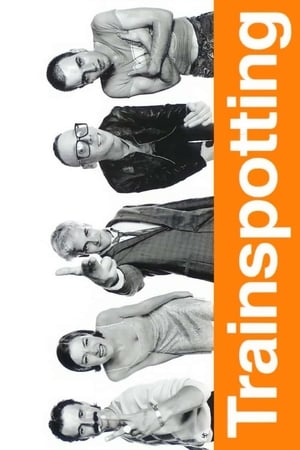Eine „Sehnsucht nach Ausdruck und Explosivität“ hat ihn, Tom Tykwer (The International), den Regisseur und Drehbuchautor des damaligen Kassenschlagers Lola rennt, angetrieben. Er wollte für ein Kino einstehen, welches sich abseits des Biedermeiermuffs eines Sönke Wortmann (Das Wunder von Bern) lokalisiert und den Zuschauer permanent aus den Sitzen (mit-)reißt. Tatsächlich gingen einige Feuilletonisten angesichts der unzweifelhaften Dynamik, die Lola rennt über seine knapp 80-minütige Laufzeit in voluminösen Tropfen ausschwitzt, sogar soweit, Tom Tykwers dritte Regiearbeit als deutsche Entsprechung von Danny Boyles Trainspotting zu betiteln – ein, letzten Endes, dann doch etwas zu hoch gegriffene Ehrenbezeigung. Dass Lola rennt aber einen Meilenstein innerhalb der deutschen Kulturlandschaft darstellt, lässt sich auch heute noch ohne weiteres nachvollziehen, ist der Film doch mit einer solch elektrisierten Spannung aufgeladen, dass es schon schwer fällt, der suggestiven Kraft von Tykwers origineller Bildästhetik zu entsagen.
Ausgangspunkt ist das Paradethema von Tom Tykwer: Natürlich geht es um das Schicksal und seine Unergründlichkeit. Die Synopsis, die für Lola (Franka Potente, Die Bourne Identität) ein Zeitfenster von 20 Minuten bereithält, um 100.000 DM aufzutreiben, die ihrem Freund, Manni (Moritz Bleibtreu, Die dunkle Seite des Mondes), das Leben rettet, liest sich vordergründig wie der High-Concept-Flic eines geschwindigkeitsliebenden Genre-Aficionados. Lola rennt aber ist mehr als reduziertes, effektvolles Kino, Tywker sucht in der Verschränkung von Schicksal und Zeit auch Antworten auf die allseits bekannten Binsenweisheiten unserer irdischen Existenz: „So ist das Leben“. Eine Plattitüde, die jeder kennt und vermutlich auch schon jeder einmal von sich gegeben hat – vielleicht aus dem Grund, weil man sich zu schade dafür war, ernsthafte Gedanken über die lebensweltlichen Strukturen unseres Seins zu machen. Tywker begegnet redensartlichen Gemeinplatz ganz entscheiden: Wer sagt, dass das Leben so sein muss?
Lola jedenfalls nicht, so viel steht fest. Die Protagonistin mit dem Feuerschopf ist immer daran versucht, eine weitere Option zu finden. Und Tom Tykwer begegnet ihrem energetischen Gemüt mit einer Situation, die sich auf drei Versuche aufteilt. Quasi einem Videospiel gleich, trifft Lola dreifach den Lauf an, um Manni vor dem sicheren Tode zu bewahren. Dreimal kann sie dazulernen, dreimal aber muss sie auch verstehen, dass das letzte Wort immer dem Schicksal selbst überlassen bleibt. Lola rennt betreibt da einen pulsierenden Hochgeschwindigkeitsfatalismus, der sowohl als Zeitgeistspiegelung funktioniert, wie auch als Reflexion über Sinn und Sein. Tywker greift dabei auf urwüchsige Motive der Kinematographie zurück, die Liebe flankiert den Tod, das Geld drängt die Protagonisten in Zeitnot. Interessant ist dabei nicht nur, wie Tywker Perspektiven variiert und auf das rechte Timing bedacht ist, sondern auch, wie der Film sein Umfeld wahrnimmt und welche gestalterischen Ausdrucksmittel er dafür findet.
Zu erst einmal sorgen die Läufe von Lola dafür, dass dem Zuschauer die innere Strukturierung der (groß-)städtischen Geographie aufgezeigt, aber in seiner Verwinkelung nie ernsthaft näher gebracht werden: Es ist die reine Gier nach Bewegung, die Lola durch das urbane Labyrinth geleitet, während um sie herum Lebenslinien unter dem beständigen Getöse anschwellender Technobeats aufklappen und in den flüchtigen Sekunden der Begegnungen aufgedröselt werden. Immer wieder nimmt der Film einen Passanten ins Visier und erzählt innerhalb einer kurzzeitig aufflackernden Fotostrecke, welches Schicksal diese Person noch erwarten wird: Manchmal wartet das gemeinsame Glück, hin und wieder bleiben nur aufgeschnittene Pulsadern. Spielerische Einfälle wie diese sind es, die Tom Tykwers grellbunte Stilistik reichhaltig und ansprechend machen, wenngleich sich Lola rennt in keinem Moment dem Vorwurf verwehren kann, voll und ganz ein Kind seiner Zeit zu sein.
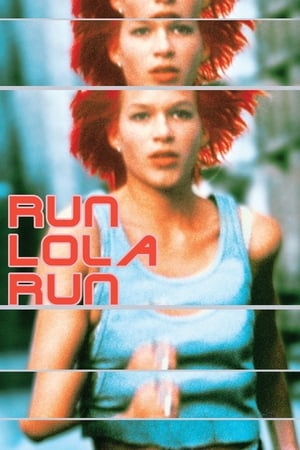 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org