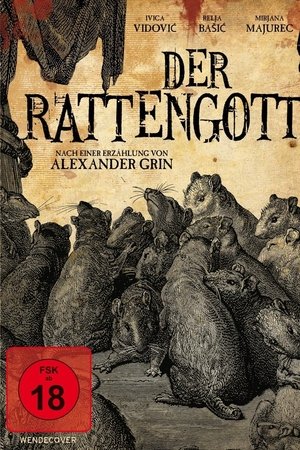Die Sonderstellung, die Laurin, das Spielfilmdebüt des Münchners Robert Sigl (The Spider), in der deutschen Kulturlandschaft eingenommen hat, ist derart außerordentlich, dass man den Film quasi vollständig aus dem allgemeinen Bewusstsein verdrängt hat. Immer wieder wird dem deutschen Kino nämlich nachgesagt, dass es keinen Platz für Genre-Werke freigibt. Oder noch extremer: Genre-Kino findet im deutschen Raum nicht einmal statt. Natürlich sind derlei Unkenrufe vollkommener Nonsens, allerdings sind die Filme, die unter diesem Label florieren, tatsächlich äußerst spärlich gesät. Was das nun mit der Sonderstellung von Laurin zu tun hat? Nun, Robert Sigl hat hier nicht einfach nur einen Genre-Film in Szene gegossen, sondern waschechten Gothic-Grusel, den man in dieser Form das letzte Mal mit Nosferatu – Phantom der Nacht von Werner Herzog gesehen hat.
Auch wenn Robert Sigl im Interview mit dem österreichischen Filmwissenschaftler Prof. Dr. Marcus Stiglegger angegeben hat, dass Werner Herzog nicht zu seinen Vorbildern zählt, so mäandert doch ein ähnlich sphärischer Glanz durch das filmische Territorium, welches Laurin über seine gut 80-minütige Laufzeit aufgefächert hat. Das beginnt mit dem Popol Vuh klanglich ähnlich gelagerten Score von Hans Jansen und Jacques Zwart, die dem Geschehen durch ihre musikalische Begleitung einen surrealen, weltentrückten Ausdruck verleihen und setzt sich in den osteuropäischen Schauplätzen fort, die, wie schon in Nosferatu – Phantom der Nacht, den Eindruck von Orten erschaffen, an denen die Welt augenscheinlich stehengeblieben ist. Und sicherlich sind die zeitweilig äußerst stilgerecht komponierten Stimmungsbilder, aus denen sich gleichwohl einige symbolisch konnotierte Angstmomente ergeben, die große und ebenso nachhaltige Stärke des Films.
Wenn man so möchte, dann verschmelzen in Laurin die Sagengestalten der Grimm'schen Märchen und die schwarze Romantik von Schauerliteraten wie Bram Stoker, Edgar Allan Poe und Mary Shelley. In einer norddeutschen Küstenstadt empfängt uns Laurin mit dem verträumten Rot einer aufgehenden Sonne, die langsam die dichte Wolkendecke am Firmament durchbricht und eine Gemeinde weckt, über dessen Frieden sich schon alsbald das Unheil legen soll. Danach richtet sich der Blick auf ein Schloss, wie man es aus klassischen Horrorfilmen kennt und manifestiert den Grundstein für eine in Düsternis getränkte Erzählung, die auf morbide Visionen der Angst und den Konventionen völkischer Dichtungen fußt: Die Unschuld, das Böse, das Verdrängte und niemals Vergessene. Durch die Kontrastierung von Signalfarben und dem grauen Schleier, der die Hafenstadt umschlingt, steigert Sigl nach und nach das Unwirkliche innerhalb der Atmosphäre des Films.
Das sich bis heute anhaltende Gerücht, Laurin würde eine Fernsehproduktion sein, kann sich allein mit dem Umstand entkräften lassen, dass der Film mit dem bayrischen Filmpreis ausgezeichnet wurde – eine, für TV-Filme, Unmöglichkeit. Obgleich es Robert Sigl immer wieder versteht, einträchtige Beklemmungen im Befinden des Zuschauers zu wecken und Laurin zur gespenstischen Sinneserfahrung zu erheben, in der nicht zuletzt die Panik vor dem Verlust der Mutterfigur thematisiert wird, um darüber hinaus – natürlich unterschwellig, aber vernehmbar - über die Gefahren väterlicher Dominanz zu sinnieren, fehlt es Laurin inhaltlich an jener Durchschlagskraft, die der Film auf der audiovisuellen Ebene freizulegen versteht. Der Schwerpunkt mag auf dem Sensorischen liegen, stofflich aber ist die gotische Mär oftmals sehr dünn gestaffelt, was den Negativeffekt mit sich bringt, dass den Fotografien gerne mal das nötige Gewicht fehlt, um wirklich memorabel auf den Zuschauer einzuwirken.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org