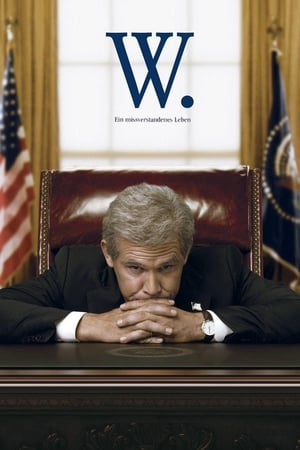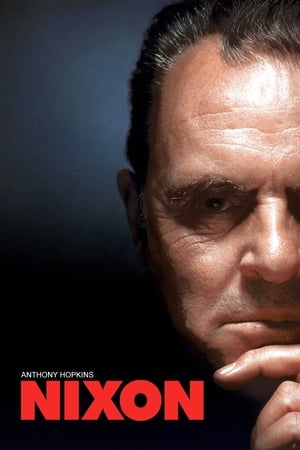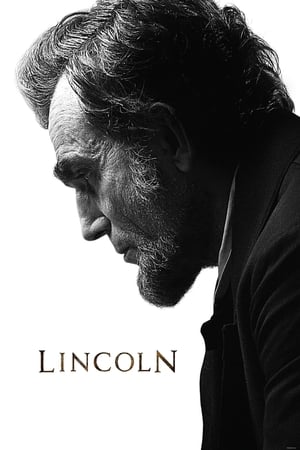Das Opening von John F. Kennedy – Tatort Dallas ist bereits ein inszenatorischer Geniestreich: Originalaufnahmen von Kennedys Ankunft in Dallas, breitgrinsend verlässt er den Privatflieger und besteigt die für ihn vorgesehene Limousine, um sich der jubelnden Menschenmasse ohne Verdeck auf der linken und rechten Seite im Stadtkern zu widmen. Kennedy ist ein Superstar, ein politisches Vorbild, einige seiner aufgebrachten Anhänger fallen in Ohnmacht, während sich die riesige Uhr am Dealey Plaza mit bleierner Schwere unerbittlich auf 12 Uhr 31 vorkämpft. Die folgenden Bilder sind allseits bekannt, drei Schüsse ertönen, Kennedy sackt in seinem Sitz zusammen, heilloses Chaos und Panik auf den Straßen. Oliver Stone verleiht diesem Augenblick jedoch ein ganz neues, beängstigendes Klima, in dem er die Archivaufnahmen wie in einer Dokumentation als einen mechanischen Ablauf selektiert, dabei aber die Militärtrommeln eines John Williams unaufhörlich wabern lässt; jeder Schlag gleicht dem Hall des Gewehrschusses, jede neue Perspektive, jedes neue Stilmittel. dient nicht nur der Illustration, sondern auch der Kombination.
Die Ermordung Kennedys ist ein bedrückendes Puzzle aus Millionen von kleinen Teilchen, die in ihrer Verbindung und öffentlichen Positionierung vollkommen deplatziert erscheinen und einen gesellschaftskritischen Zweifler wie den oftmals kontrovers diskutierten wie gerne verschmähten Regisseur Oliver Stone zur künstlerischen Höchstleistung antreiben. Dabei war Oliver Stone immer ein Filmemacher, der sich den relevanten Themen seiner Generation und Nation gestellt hat, der eine eigene Meinung vertreten hat, die sich auch als selbstreflexives wie bewältigendes Statement durch die Filmhistorik bewegte, wenngleich er nicht immer den richtigen Ton getroffen hat und auch mal zu einem Resultat gelangte, welches ihm während der Herstellung des Werkes rein gar nicht in den Sinn gekommen ist. Bestes Beispiel: Michael Douglas' schmieriges Kapitalistenschwein Gordon Gecko, ein Scheusal, der plötzlich einen mehr als heldenhaften Rang zugesprochen bekam. In John F. Kennedy – Tatort Dallas kommt es zu einem ähnlichen Problem, nur, ist in diesem Fall nicht die Perzeption des Zuschauers schuldig zu sprechen, sondern Stones' undifferenzierte Charakterisierung.
Mit der Figur des Jim Garrison möchte Oliver Stone seinem Publikum einen idealistischen Saubermann vorstellen; einen Bezirksstaatsanwalt aus New Orleans, der sich für Recht und Ordnung einsetzt und nach dem strengen Kodex der Gerechtigkeit agiert, ohne sich selber in so manches Schlagloch zu katapultieren. Verkörpert wird dieser engagierte Strahlemann von dem damals überaus beliebten Kevin Costner, ein Frauenschwarm und Kassenmagnet – Und frischgebackener Oscargewinner. Es liegt nun keinesfalls an Costners Darbietung, der macht seine Sache außerordentlich gut und weiß sein Charisma auf die Rolle des nach Wahrheit eifernden Anwalts problemlos zu übertragen. Nur die weiße Weste, die Oliver Stone seinem Dreh- und Angelpunkt zusprechen möchte, die ist genauso heuchlerisch wie seine Medien-Kritik im drei Jahre später folgenden Natural Born Killers, schließlich war Garrison in Kontakten zum organisierten Verbrechen verstrickt und soll Zeugen reichlich indiskret bedroht haben. Ein kleiner Riss in dem ansonsten mehr als beeindruckenden Gesamtbilde.
Wenn wir uns aber auf den eigentlichen Inhalt konzentrieren und uns von Oliver Stones audiovisuelle Vorliebe für die stilistische Vielfalt, die auch hier wieder konsequent auftritt und in den verschiedensten Formaten und Ausmaßen ausgelebt wird, distanzieren, gerade weil sie die informale Ebene nicht bedrängt, und auch den famosen Cast mit Leuten wie Jack Lemmon, Walter Matthau, Joe Pesci, Gary Oldman, Tommy Lee Jones und Donald Sutherland in den Hintergrund rücken, dann wird es auf dem handlungstechnischen Plateau im höchsten Maße interessant. Zu allererst ist es schon erfreulich, dass der strahlende Protagonist Jim Garrison noch kundtun darf, dass er sich für sein Vaterland mehr als schämt und Oliver Stone ihm entgegen jeden Patriotismus derartige Sätze in den Mund gelegt hat. Dabei ist diese Aussage eben nicht nur irgendeine Phrase, eine intuitive Momentaufnahme, John F. Kennedy – Tatort Dallas ist auch ein auf Zelluloid gebannter Lanzenstoß in das Gewissen einer von A bis Z getäuschten Nation, die sich in ihrer Blauäugigkeit dem medialen Lügenkonstrukt und den politischen Hypokriten leichtsinnig hingegeben haben.
Kein Wunder also, dass die damalige Presse beinahe Amok gelaufen ist, dass Oliver Stone Drehbücher gestohlen wurden und er sich der Verachtung unzähliger Personen stellen musste: Die Wunden klafften auch noch 28 Jahre später, und sie werde auch weiterhin schmerzen, wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit. In John F. Kennedy – Tatort Dallas geht es deshalb auch nicht nur allein darum, eine Verschwörungstheorie um den Tod des Präsidenten glaubwürdig zu chiffrieren, es ist auch ein Appell an die globale Bevölkerung, die nicht immer das fressen soll, was ihnen durch sogenannte „Respektspersonen“ und die Medien vorgegaukelt wird. Vor allem doch dann nicht, wenn die Ungereimtheiten in einem derart eklatanten Umfang auftreten und keinerlei analoge Aufklärung zulassen. Mit Lee Harvey Oswald hatte man dann einen Verantwortlichen, die Achse des Bösen und ein greifbares Bild des Attentates. Oliver Stone schüttelt entrüstet den Kopf, denn die Diskrepanz beginnt bereits bei der zeitlichen Schussfolge, in der in wenigen Sekunden drei Schüsse abgegeben wurden, die nie und nimmer nur von einer Person getätigt werden konnten.
In John F. Kennedy – Tatort Dallas stehen drei Fragen im Zentrum des Geschehens: Wieso wurde Kennedy getötet? Wer profitiert von seinem Tod? Wer hat die Macht dieses Verbrechen zu (ver-)decken? Dabei lässt sich Oliver Stone knapp 200 Minuten Zeit um diesen Fragen eine Antwort zu ermöglichen und analysiert Details, präzisiert Einzelheiten und dringt in ein Gefilde aus Manipulation, Machtmissbrauch, Korruption und Sabotage – Die Einzeltätertheorie wird nicht nur hinterfragt, sie wird dekonstruiert und stellt sich problemlos als völliger Mumpitz heraus. In einem Dreieck aus Exilkubanern, rechtsradikalen Schattengestalten und ehemaligen FBI- und CIA-Agenten wird recherchiert, bis die Spur irgendwann ins Sammelbecken des militärisch-industriellen Komplexes (MIK) führt. Natürlich versteift sich Oliver Stone auf fiktive Vermutungen; Vermutungen auf starke außenpolitische und ökonomische Zusammenhänge, die sich faktisch natürlich (noch) nicht belegen lassen. Doch die Adaption von Garrisons eigener Sichtweise ist auch die akribisch katalysierte Hoffnung, einem Land die verlogenen Splitter aus dem Auge zu ziehen.
John F. Kennedy – Tatort Dallas lebt von seinen Thesen, von Theorien und Spekulationen, doch je tiefer Oliver Stone seinen Hauptdarsteller bohren lässt, desto größer werden die Schnittstellen und Hohlräume, desto größer die Fragen, auf die es keine Antworten zu geben scheint, irgendwo im stickigen Dickicht aus Krieg und dem elendigen Geld. Wenn Kevin Costner am Ende in einem Gerichtsaal explodiert, Lincoln-Zitate am laufenden Band abfeuert und das moralische Plädoyer auf den orgastischen Höhepunkt zusteuert, dann ist das überzogen, dann hat das nichts mit der Realität zu tun, doch es passt letztlich in das evozierte Bild, seinen eigenem Konzept ein Fundament zu verleihen, es wenigstens zu versuchen, auch wenn man scheitern muss. Dabei wird dem Film auch genau das Feeling zugesprochen, wie es sich lediglich die echten 70er-Jahre-Polit-Thriller aneignen durften. Oliver Stone ist mit John F. Kennedy – Tatort Dallas auf der Höhe seines Schaffens angekommen, ein mutiges, hochspannendes und höchste Konzentration forderndes Mammutwerk. Da können die Amis auch heute noch gerne so viel Feuer spucken wie sie wollen, Stones Opus Magnum trifft genau die richtigen Töne, auch wenn sie das nicht wahrhaben wollen/können/dürfen.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org