Immer wieder wächst das Gras. Wild und hoch und grün, bis die Sense ihre Kreise ohne Hass zieht. Und immer wieder wächst das Gras, klammert all die Wunden zu. Manchmal stark und manchmal blass, so wie ich und du.
Dem deutschen Kino wird oftmals – und das sicherlich nicht gänzlich unberechtigt – vorgeworfen, sich schwerpunktmäßig in zwei historische Abschnitte festzubeißen: Da wäre das schwarze Kapitel des zweiten Weltkrieges und die graue Periode der DDR. Tatsächlich erwischt man sich selbst auch immer wieder dabei, wie man auf jene Ankündigungen, die ein neues, hochgradig gelungenes und erstaunlich bedeutsames Geschichtsepos aus der Heimat versprechen (gerne in absurder Verbindung mit einem möglichen Auslandsoscar), mit teilnahmsloser Abneigung reagiert. Die Gründe dafür liegen natürlich auf der Hand, erzwingen die ewig gleichgeschalteten Bilder, das undifferenzierte Schubladenken und die läppische Dialektik zwischen Gut und Böse, zwischen dem Heiligen und dem Infernalischen, auf Dauer nun mal einen unüberwindbaren Ermüdungseffekt. Dass Ausnahmen jedoch die Regel bestätigen, beweist Andreas Dresen (Halt auf freier Strecke) mit seiner neusten Regiearbeit.
Wer noch nie etwas von Gerhard Gundermann gehört hat, muss sich nicht grämen und seinen geisten Horizont hinterfragen: In Westdeutschland ist der Liedermacher, der sein täglich Brot als Baggerfahrer verdiente, weitestgehend unbekannt. Im Osten hingegen wurde der gebürtige Weimarer zur Ikone, die gerade in der Vorwendezeit die Herzen unzähliger Genossen mit ihren poetischen Texten erreichte und berührte. Gundermann, an dem sich nicht nur die bundesdeutsche Dichotomie in Sachen kultureller Wahrnehmung aufzeigt, wurde zu einer Symbolfigur der DDR: Denn obwohl er für den Widerstand lebte, seine Worte dementsprechend wählte, wie ihm der Mund gewachsen war, kooperierte er mit der Staatssicherheit. Ein Mensch, so widersprüchlich wie das System, in dem er lebte. Andreas Dresen widmet dieser Persönlichkeit einen gleichnamigen Film – und offenbart damit womöglich seinen bis dato besten.
Mit Gundermann veranschaulichen Dresen und seine Drehbuchautorin Laila Steiler vor allem, dass diese Art von Geschichtskino es nicht nötig hat, vorgeschriebenen Kategorisierungen unterzogen zu werden, ohne es sich im nächsten Schritt damit nehmen zu lassen, eine Untersuchung moralischer Verhältnisse darzustellen. Wir folgen Gerhard Gundermann zwischen den 1970er und 1990er Jahren, die Zeitebenen werden dabei nicht chronologisch sortiert, sondern fügen sich in Form einer Parallelmontage zusammen, die den Malocher und den Künstler, den Familienvater und den Träumer in seiner von Ambivalenzen gesäumten Lebensphilosophie gegenüberstellen. Mit diesem dramaturgischen wie erzählerischen Vorgehen arbeitet Dresen gezielt die ethische Zwickmühle heraus, in der sich der Mann, der 1998 unvermittelt im Alter von 43 Jahren an einem Hirnschlag verstarb, wiederfindet. Morgens wartet die apokalyptische Kraterlandschaft der Kohlegewinnung, abends die Bühne.
Das Doppelleben Gundermanns, dem noch eine weitere Ebene durch sein Dasein als Stasi-Spitzel anhaftete, beschreibt Andreas Dresen ohne jeden Anspruch auf große Gesten und grell-übersättigtes Emotionsgeheische. Stattdessen brilliert der Film als präzises, ungemein menschennahes Charakter-Portait um einen sich selbst verratenden Querdenker, der von den Mühlen des real existierenden Sozialismus verschlungen worden ist – und dadurch ein Leben akzeptieren musste, welches ihm als Opfer mit der Täterakte einen Platz zwischen den Stühlen zuweisen sollte. Es ist indes auch der Verdienst des formidabel aufspielenden Alexander Scheer (Gladbeck), der dem Film in der Hauptrolle Kontur, Tiefe und ein ausgefeiltes Differenzierungsvermögen zuspricht; ihn echt, greifbar und schwierig macht. Schwierig deshalb, weil es hier um Menschen aus Fleisch und Blut geht, nicht um das Abgrasen vorgefertigter Allgemeinplätze. Ein echter Gewinn.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org




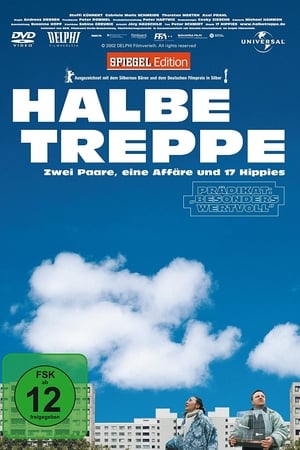


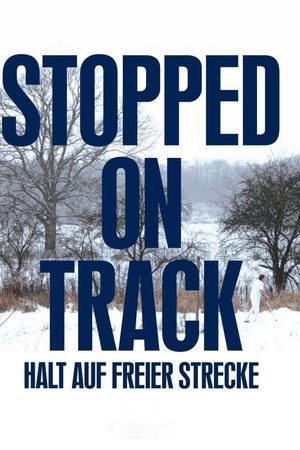
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!