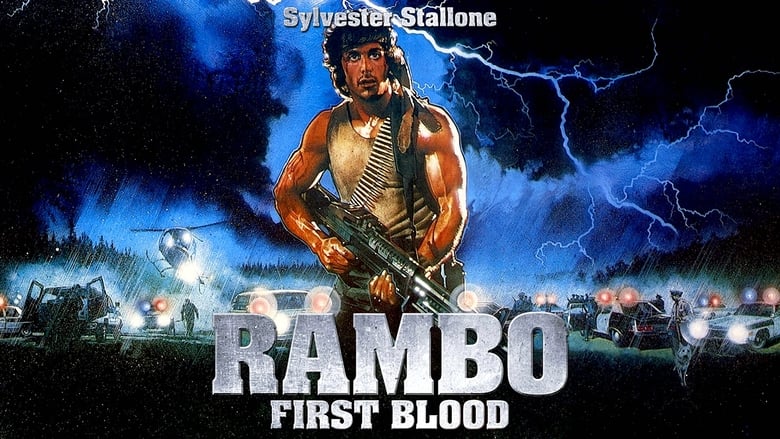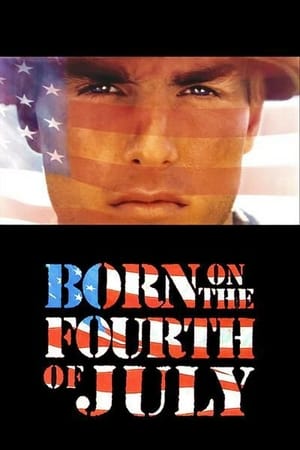Rambo. Ein geflügeltes Wort, welches sich längst schon in unseren allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert hat. Verbunden wird damit zumeist eine Person, die sich dadurch auszeichnet, den kürzesten Weg zur nächsten Konfrontation mit Vorliebe zu wählen; jemand, der Widerständen mit chronischer Trotzhaltung begegnet und nur allzu gerne mit dem Kopf durch die Wand bricht. Dass sich das Wort 'Rambo' ebenfalls im Japanischen finden lässt und als „unstillbare Gewalt“ übersetzen lässt, schließt den Kreis in dieser Hinsicht wohl akkurat. Und dass der erste amerikanische Soldat, der dem Vietnamkrieg zum Opfer gefallen ist, auf den Namen Rambo gehört haben soll, führt uns an dieser Stelle schon einmal näher an das eigentliche Thema: Den gleichnamigen Klassiker aus den 1980er Jahren. Entgegen zahlreicher Unkenrufe, die sich immer wieder auftun, wenn „Rambo“ Gegenstand einer Diskussion wird, hat Ted Kotcheff („Die verwegenen Sieben“) keinen dumpfbackigen Reißer gedreht, sondern eine nach wie vor herausragende Auseinandersetzung mit einem vom Krieg gebeutelten Nationalbefinden.
Die ersten Bilder versprechen ein Leben im Idyll: Schneebedeckte Bergketten, ein in sich ruhender See, an dessen Oberfläche sich die Mittagssonne bedächtig spiegelt, und Wiesen, Weiden und Felder, so weit das Auge nur reicht. Diesen Bildern aber lässt sich schnell ein thematischer Kontrapunkt entziehen, mit dem sich „Rambo“ infolge durchgehend beschäftigen wird. Ein Idyll, auf dem Heimat geschrieben scheint, doch welches schlicht nicht Heimat sein kann. John Rambo (Sylvester Stallone, „Creed – Rocky's Legacy“) ist Veteran und zurück in seinem Mutterland. Er durchquert genau diese verträumten Postkartenmotive, in dessen Mitte sich die erste Enttäuschung anbahnt: Einen alten Kameraden möchte er besuchen, doch der Krebs war schneller. Schon hier spricht „Rambo“ einen schwerwiegenden Aspekt an, der sich bis heute als bedrückende Konstante in unserer Gesellschaft bestätigt – Die Existenzangst. Seinen alten Freund zu treffen, mit dem er zusammen gedient hat, gab Rambo eine Art von Lebensziel. Mit dem Verlust dieses Freundes tritt auch der Verlust eines Lebenssinns ein.
Als Heimatfilm wird „Rambo“ besonders tragisch, weil er, wie bereits angesprochen, verdeutlicht, dass diese Heimat für manche Menschen jener Generation nicht mehr existent scheint (Vergleiche zu „Taxi Driver“ und „Die durch die Hölle gehen“ scheinen in dieser motivischen Haltung nicht unangebracht). Während Rambo im Krieg eine große Nummer war, einen klar geordneten Tagesablauf besaß, über Ausrüstung im Millionenwert verfügte, Medallien bekam, wird er in Amerika der Landstreicherei bezichtigt. Erst recht nicht möchte man durch seine Präsenz damit konfrontiert werden, was Vietnam aus Amerika gemacht hat. Ein Provinzsheriff (Brian Dennehy, „Knights of Cups“) nimmt Rambo schnell in Gewahrsam, als dieser sich nicht bereit erklärt, die Kleinstadt zu verlassen. Andere Polizisten misshandeln Rambo – und die Maschine erwacht. Den Krieg kann man nicht aus Rambo vertreiben werden, weil er gezwungen wurde, selbst zum Krieg zu werden. Wenn sich Rambo seinen Weg aus dem Polizeidepartement freikämpft, wird ersichtlich, dass Gewalt die einzige Ausdrucksform ist, die dieser beinahe lebensmüde wie antriebslose Mann noch beherrscht.
Der Kampf ums Überleben, wenn Rambo sich in den Wäldern versteckt und offenbart, dass der Polizeiapparat keine Chance hat, ihn zu überwältigen, ist freilich tadellos inszeniertes, spannungsgeladenes Action-Kino. Rambo veranschaulicht seine in Einzelkämpfer-Ausbildungen erlernten Fähigkeiten, in jedweder Lage aus eigener Kraft zu bestehen. Der elementare Punkt jedoch ist, dass „Rambo“ sich damit begnügt nicht und keinesfalls stehenbleibt. Ted Kotcheff erzählt immerzu über das Dargestellte hinaus, er dokumentiert John Rambo als Aushängeschild eines Kollektivs, welches nur noch in der Verfassung ist, für Ideale einzutreten, die mit der zivilen Lebensrealität nichts mehr gemein haben. Mit Col. Trautman (Richard Crenna, „Jade“) fächert „Rambo“ seinen kritisch konnotierten Tiefgang dann weiter auf. Der Mann, der Rambo zur Kampfmaschine gedrillt hat, soll nun dafür sorgen, dass „sein Junge“ den kriegerischen Modus wieder ablegt und aufgibt. Wenn Rambos finaler Monolog in einem Tränenschwall kulminiert, liegt auf der Hand, worum es hier geht: Nicht um Ehre, um Mut, um Stärke. Es geht allein um Menschwerdung.
Rambo hat jemanden gebraucht, der gesehen hat, was er gesehen hat. Dabei geht es ihm auch gar nicht darum, ob Col. Trautman ebenso fühlt, wie er es tut. Es geht ihm nur darum, sich einem Menschen zu öffnen, zu dem er gewissermaßen eine Form der Verbundenheit pflegt. Und diese Verbundenheit ist der ausschlaggebende Faktor, mit dem Rambo sich zurück zum Menschen entwickeln kann, weil er sich einer Sache hingegeben hat, die ihm zuvor strengstens untersagt wurde: Emotionen. „Rambo“ wirkt da wie ein Abgesang auf den archetypischen amerikanischen Heldentypus. Hier giert es niemanden nach Krieg, es lebt der Wunsch nach Resozialisierung und Neuanfang. Nach einer Perspektive. Nach dem, was sich Rambo hier während der gesamten Laufzeit vehement verweigert hat, weil die Schatten der Vergangenheit zu schwer wiegen: Einer Heimat. Dass „Rambo“ immerzu auf die Bedeutung des geflügelten Wortes dahinter reduziert wird, lässt sich darauf zurückführen, dass „Rambo II – Die Auftrag“ und „Rambo III“ tatsächlich alles dafür getan haben, den pazifistischen Kern des Erstlings aus der Welt zu feuern.