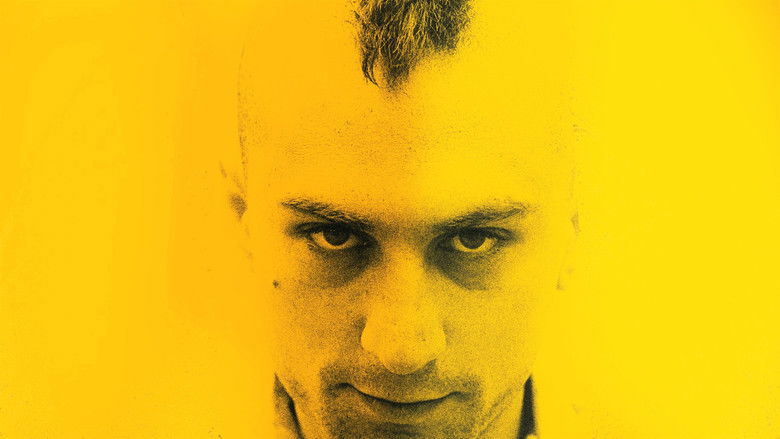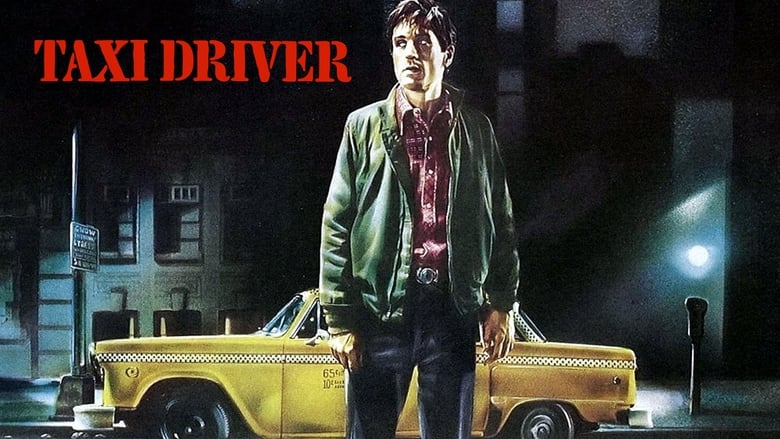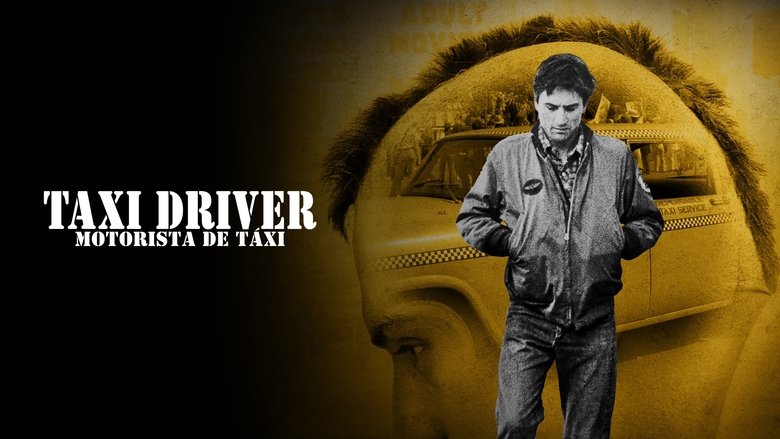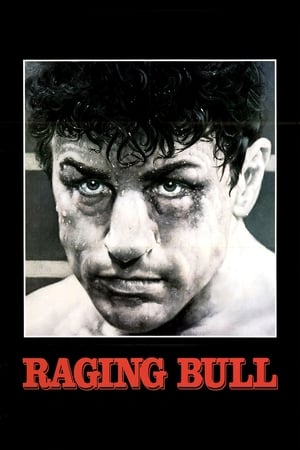Entstanden im Hollywood der 1970er Jahre, zweifellos der wildesten und experimentellsten Zeit der Traumfabrik, ist Taxi Driver ebenso stark im europäischen Kino verortet, wie er die Probleme seines Herkunftslandes seziert. Bezeichnend dafür ist auch die Prämierung mit der Goldenen Palme in Cannes, wohingegen er sich bei den Oscars mit einigen Nominierungen zufriedengeben musste. Auf Preise hat es Martin Scorsese (Silence) aber ohnehin nicht abgesehen. Überhaupt scheint es aus heutiger Sicht unmöglich, dass ein Film wie dieser von einem großen Studio finanziert oder gar für die Oscars in Erwägung gezogen wurde. Dafür ist er zu radikal, ästhetisch wie inhaltlich stark an einem gesellschaftspolitischen Diskurs interessiert, der zu dieser Zeit besonders aktuell war, genaugenommen aber noch immer präsent ist. In ein schmeichelndes Licht wird Amerika dabei freilich nicht gerückt und so ist der Protagonist Travis Bickle ein vermenschlichtes Symbol für den Verfall und die Probleme einer ganzen Gesellschaft.
Obgleich Taxi Driver als schauspielerischer Durchbruch Jodie Fosters (Das Schweigen der Lämmer) oder durch einen langhaarigen Harvey Keitel (Reservoir Dogs) jede Menge darstellerische Potenz besitzt, reißt Robert De Niro (Goodfellas) den kompletten Film problemlos an sich. Ganz New York ist seine Bühne, wenn er schäbig auf dem Fahrersitz seines Taxis versinkt und auf seinen nächtlichen Touren den gesellschaftlichen Morast von den Bürgersteigen auflesen muss. Beinahe demütig gibt sich De Niro diesem Charakter hin. Man sieht nicht ihn, sondern nur Travis Bickle, einen desillusionierten Vietnamheimkehrer, der, wie es die triste Bildgestaltung von vornherein verdeutlicht, unter unausgesprochenen Problemen leidet. Er ist einer von vielen, der versucht ein funktionierender Teil der Gesellschaft zu werden und in seinem Unvermögen seine eigenen Probleme in einen übergeordneten Konflikt projiziert. Seinen Diskurs verhandelt Taxi Driver primär in diesem Spannungsfeld aus Charakterdrama, Gesellschaftskritik und Milieustudie, was gerade in der gegenseitigen Wechselwirkung ungeahnte Dimensionen eröffnet.
Dabei scheint Travis eigentlich ein Jedermann zu sein. Seine Einsamkeit ertränkt er in Überstunden, die Isolation der Großstadt lastet auf seiner Seele und eigentlich will er bloß geliebt werden. Betsy heißt sein Objekt der Begierde und weil er eben nicht genau weiß, wie man Frauen erobert, führt er sie kurzerhand in ein Schmuddelkino. Der Anfang vom Ende, der die Tragik von Travis jedoch passend auf den Punkt bringt. In seiner Rolle als frustrierter Außenseiter hat er längst den Kontakt zu allem verloren, was als normal gilt und von der Gesellschaft akzeptiert wird. Und so scheitert er, trotz bester Intention, gnadenlos an den Paradigmen der gutbürgerlichen Sitte. Auch in seiner Einstellung zur Politik spiegeln sich zeitlose Probleme. Einen lokalen Politiker und zukünftigen Präsidentschaftskandidat unterstützt er nur wegen seinem Interesse an Betsy, die sogar in dessen Wahlkampfbüro arbeitet. Als dieser Mann dann tatsächlich in Travis Taxi steigt, versichert er diesem zwar seine felsenfeste Unterstützung, aber auf die Frage nach seiner eigenen Meinung gibt er sich ganz unpolitisch und antwortet, dass er von Politik keine Ahnung hätte, aber dennoch genau wüsste, dass er der richtige Mann ist.
Gegen Ende offenbart Taxi Driver bissigen Zynismus, wenn Travis verzweifelter Gewaltmarsch als Rettungsmission und seine egoistische Opferung als selbstlose Tat missverstanden wird. Er ist ein Mann, der möglicherweise das Richtige tut, aber aus den falschen Beweggründen handelt und sich dafür bei den falschen Mitteln bedient. Damit porträtiert der Film auch die Gratwanderung zwischen Opfer, Täter und Held, sowie die Fragwürdigkeit medialer Darstellung. Wie schnell das augenscheinlich Normale in sein Gegenteil kippen kann, führt Scorsese auch immer wieder formal vor. Indem der Film eine Einstellung einen Moment zu lange hält, einen Zoom einen Hauch zu nah ans Geschehen bringt oder ein Geräusch einen Tick zu laut abspielt, erzeugt er ein Unwohlsein, welches Travis Gefühlswelt eindringlich einfängt. Die Stärke der Inszenierung liegt in dieser sehr unscheinbaren, aber unglaublich wirkungsvollen Immersion. Travis als sozialer Außenseiter, aber auch als Symbol unserer Angst davor ausgeschlossen zu werden.
Einen guten Film erkennt man auch immer daran, dass er uns nach dem Verlassen des Kinos nicht sofort verlässt, sondern wie ein Phantom im Kopf herumspukt. An dem was nach der kritischen Auseinandersetzung noch hängen bleibt, an Ideen, Gedanken und Träumen. Manchmal ist es ein verschmitztes Lächeln oder der verblassende Nachhall einer charakteristischen Geste, die daraufhin unbedacht, beinahe nebensächlich in unser Repertoire aus alltäglichen Bewegungen aufgenommen wird. Es sind besondere Momente, wenn ein Film die Leinwand verlässt und wir fortan immer ein Stück von ihm mit uns herumtragen. Wenn wir uns beim lethargischen Weg durch die einsame Stadt so unnahbar wie Alain Delon in Der eiskalte Engel fühlen oder Versuchen einer Frau so verführerisch in die Augen zu sehen wie es einst Humphrey Bogart mit Ingrid Bergman in Casablanca gemacht hat. Auch Taxi Driver ist einer dieser Filme, wenn wir selbst vorm Spiegel stehen, De Niros markantesten Moment nachspielen und dabei ein Stück weit seinen Wahnsinn, seine Trauer, seine Wut spüren.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org