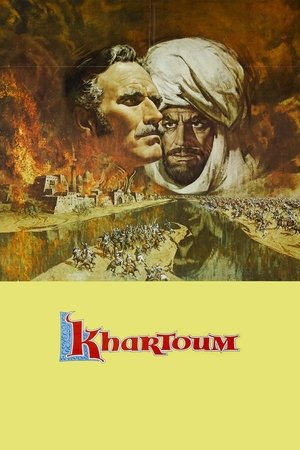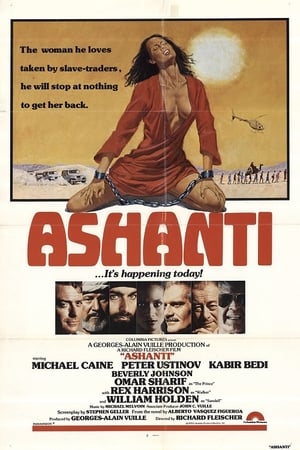Für so viele Filme ist John Milius in seiner unlängst als beendete zu betrachtenden Karriere gar nicht direkt verantwortlich, sei es als Produzent, Autor oder Regisseur. Trotzdem ist er nicht vergessen, was wahrscheinlich am ehesten an zwei Regiearbeiten aus den wilden 80ern liegen dürfte: Arnie’s erste, wichtige Hauptrolle in Conan, der Barbar und das mehr als nur fragwürdige, aber in seiner scheußlichen Unverfrorenheit schon fast legendäre Machwerk Die rote Flut. Sein damals dritter Spielfilm Der Wind und der Löwe muss für den gerade mal 31jährigen gewirkt haben wie sein persönlicher Lawrence von Arabien und in gewisser Weise – wobei der Vergleich nun wirklich extrem grob und Kontext-abhängig ist -, könnte man ihn fast als solchen bezeichnen.
Lose beruhend auf einem wahren Zwischenfall, der im Jahr 1904 eine brisante, beinah Weltkriegs-auslösende Situation in Marokko hervorbeschwor, die gleichzeitig dem damals als Übergangs-US-Präsidenten tätigen Theodor „Teddy“ Roosevelt praktisch zu seiner zweiten Amtszeit verhalf. Tja, Kriege, Krisen und Konflikte, darauf werden mancherorts Wiederwahlen fundiert. Die Entführung eines US-Staatsbürgers und dessen Kinder durch einen Berber-Clan, womit eine internationale Eskalation bewusst heraufbeschworen werden sollte. Das sind die groben Fakten, nicht zu leugnende Namen stimmen auch, ansonsten spinnt man sich unverkrampft ein auf pure Unterhaltung getrimmtes, exotisches Abenteuer-Vehikel zusammen, das dahingehend nicht nur sogar recht anständig funktioniert, sondern durchgehend ganz wunderbar aussieht. Der US-Bürger ist in diesem Fall – nicht wie in der Realität – eine Frau. Für den dramaturgischen und besonders romantischen Effekt. Eden Pedecaris (Candice Bergen, Kanonenboot am Yangtse-Kiang) und ihre beiden Kinder werden vom letzten, unabhängigen Berber-Rebellen Raisuli (Sean Connery, Der Name der Rose) gekidnappt. Was zunächst wie eine reine Lösegeld-Erpressung erscheint, entpuppt sich als politischer Schachzug. Denn dadurch soll der auf eine Wiederwahl erpichte und hitzköpfige US-Präsident Roosevelt (Brian Keith, Yakuza) gekitzelt werden, die politisch undurchsichtige Situation eines von Europäern, Amerikanern und korrupten Herrschern zerrissenen Landes durch einen militärischen Eingriff mit einem Paukenschlag zu bereinigen.
Klingt plump, funktionierte aber selbst in der Realität (fast) wie geplant. Zumindest wurde ein kleiner Putsch ins Leben gerufen, der die Karten bei der noch halbgaren Verteilung von Marokko unter den zahlreich vertretenden Besatzern entscheidend beeinflusste. Die politische Situation verwendet Der Wind und der Löwe erstaunlich konkret als satirisches Mittel, greift er doch gerne auf sarkastische und sogar US-kritische Seitenhiebe zurück, in dem er speziell Teddy Roosevelt als einen bodenständigen, aber auch reaktionären, diplomatischen Grobmotoriker inszeniert, was sich ja ansatzweise selbst auf heutige Zustände transferieren ließe (man streiche bitte das „bodenständigen“). Brian Keith hinterlässt in seiner Nebenrolle als 26. US-Präsident einen starken Eindruck. Indem er seinen Teddy nicht zu einer Karikatur macht, sie aber gleichzeitig mit einem ironischen Augenzwinkern anlegt und dabei der realen Person vermutlich sehr nahe kommt. Der Film findet immer wieder ganz neckische Vergleiche, wie z.B. wenn nach einer patriotischen Kampfansage von Roosevelt gegen „die Wilden“ seine Anhänger vor Begeisterung in die Luft ballern und in der direkten Anschlussszene die Wüstensöhne es ihnen gleich tun, während sie einreiten. Was die Frage aufwirft, ob die einen weniger barbarisch und deutlich zivilisierter sind, nur weil sie die jüngere und angeblich fortschrittlichere Nation sind.
Das politische Wirrwarr wird unterhaltsam verarbeitet, verpackt in kraftvolle Aufnahmen vor hervorragend ausgestatteten Kulissen. Mitten drin Sean Connery, der sich mal wieder eigentlich nur selbst spielt, da muss das Outfit eben regeln, wen oder was er direkt verkörpert. Es macht auch wie gewohnt Spaß, diesem Charme-Bolzen dabei zuzusehen, aber überzeugend ist er genau genommen überhaupt nicht. Wenn er bei Enthauptungen sein schlitzohriges Schlafzimmer-Lächeln aufsetzt – vermutlich einfach, weil es gut aussieht – oder durchgehend ein skurriles Kauderwelsch auftischt, das klingt wie bei mittelprächtiger Stand-Up-Comedy. Eigentlich viel zu gutes Englisch mit schlecht imitierten, gebrochenen Araber-Akzent, bei dem sein schottischer Einschlag aber trotzdem so prägnant durchkommt - es ist ein einziges Durcheinander. Der nimmt seine Rolle deutlich weniger ernst, als sie es vertragen könnte. Aber ein gutes Pferd springt oft nur so hoch, wie es muss. Und Connery kommt über das Hindernis locker rüber. Der gesamte Film ist nämlich kaum mehr als hübsch anzusehendes, flottes Abenteuerkino mit klassischem Einschlag und einer kleinen, ironischen Note. Was ja grundsätzlich auch völlig in Ordnung ist.
-„You are a dangerous man. And your president Roosevelt is mad.“
-„Yes, sir!“
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org