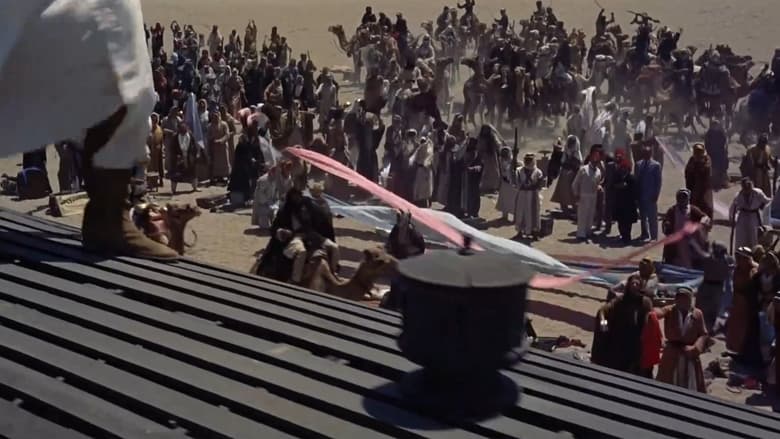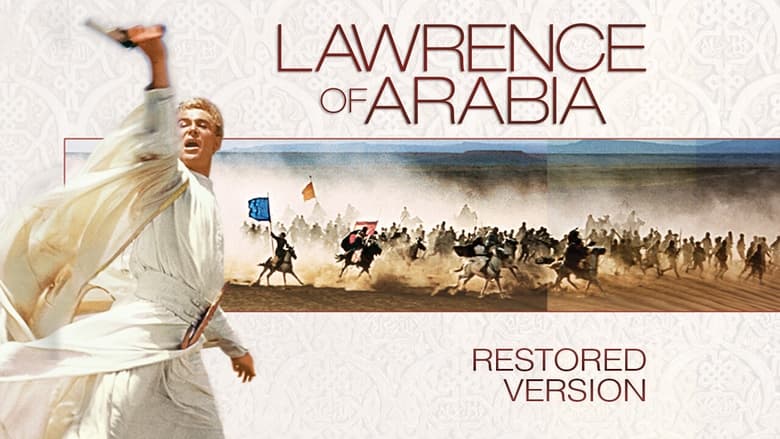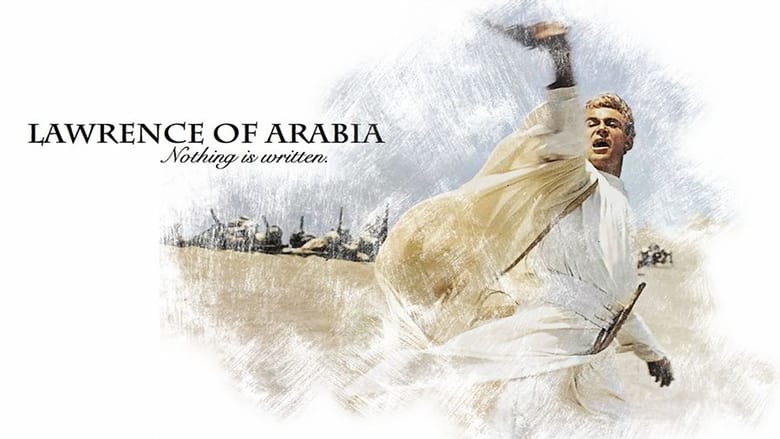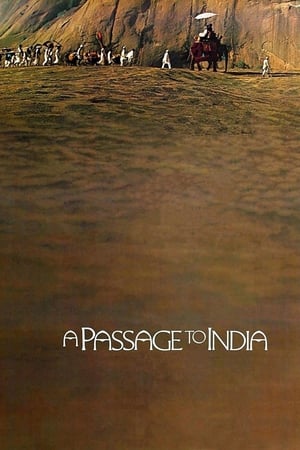Lawrence von Arabien ist ein Filmtitel, der mittlerweile zu einem Statement geworden ist. Hier gibt es mehr zu sehen, als rechteckige Bilder, die einem vierundzwanzig Mal in der Sekunde in die Augen geschossen werden. David Lean (Doktor Schiwago) hat das Unmögliche möglich gemacht, ist in die Wüste gezogen, hat eine bombastisch riesige Filmproduktion geleitet. Das Ergebnis verschlägt einem gerne mal den Atem - nicht, weil man Sand in der Lunge hätte, sondern weil man eine derartige Bildgewalt nicht alle Tage zu sehen bekommt. Der Film basiert dabei lose auf dem autobiographischen Text Die sieben Säulen der Wahrheit des Britischen Offiziers T.E. Lawrence, genannt Lawrence von Arabien (Peter O’Toole, Der letzte Kaiser). Die historische Authentizität ist keine Priorität für Regisseur Lean. Er ist viel mehr daran interessiert, ein Abbild des Ersten Weltkrieges zu nutzen, um die fragwürdigen Expansionspraktiken der Weltmächte zu untersuchen und kritisieren - natürlich zu Zeiten des Vietnamkrieges.
David Lean charakterisiert Lawrence früh mit dem ersten Bild; ein berühmter Mann, der große Krieger, der Held vieler Völker, der große Diplomat und Anführer - er wird von oben gezeigt. So groß wirkt er gar nicht. Penibel kümmert er sich um sein Motorrad, fährt dann los und kümmert sich weniger um die Gefahrenschilder einer Baustelle. Lawrence rast in seinen Tod. Ihm zu Ehren wird eine Bronzebüste aufgestellt. Mit der Frage einiger kritischer Besucher, ob der Verstorbene diese verdient habe, schreitet der Film zurück und erzählt das Leben von T.E. Lawrence, der zunächst einen unwichtigen Job in Kairo innehat. Er wird nicht wirklich akzeptiert, gibt sich eher albern und hat (absichtlich?) Schwierigkeiten mit all den Militärgesten und Geflogenheiten, an die er immer erinnert werden muss. Lean inszeniert dabei nicht ohne Humor. Lawrence Vorgesetzter ist ein Dummbatz, der nur das sagt, macht und weiß, was ihm vorgekaut wird. „Ich sehe, Sie sind gebildet. So steht es in Ihrem Dossier.“ Und so jemand soll die Weltordnung zum Guten wenden? Viel Erfolg.
Doch der Kern des dreieinhalbstündigen Meisterwerks ist Lawrence und sein Kampf mit sich selbst, sein Kampf mit seinem Götterkomplex. Er wird vor der Wüste gewarnt; Beduinen und Götter hätten Spaß in der Wüste, für alle anderen sei es das Verderben. Lawrence wird nach und nach zu beidem zählen. Mit einem Leichtsinn, der Lawrence schon in der ersten Szene des Films - seinem Motorradunfall - anhaftet, nimmt er die Aufgabe an, in die Wüste zu gehen. Er hält ein brennendes Streichholz, lächelt, pustet es aus. Cut. Glutroter Himmel der aufgehenden Wüstensonne. David Leans Match Cut galt als der berühmteste der Filmgeschichte. Er wurde zwei Jahre später von Stanley Kubrickim Weltall abgelöst. Der glutrote Himmel, die feurige aufgehende Sonne. Wahrlich ein Anblick für die Götter und eine brandheiße Warnung an alle Menschen. Menschen? Da fühlt Lawrence sich nicht angesprochen. Er ist ein draufgängerischer, mutiger und kluger Mann, der höchstens von den Aufgaben ernsthaft gefordert wird, die er sich selbst stellt.
„Es steht geschrieben.“ argumentieren die zu vielen Stämmen gehörenden Araber stets, wenn sie sich mit der Gesamtsituation zufrieden geben. Gott habe es so vorgesehen. Lawrence verweigert sich diesem Satz mehrfach. Nichts ist für ihn geschrieben. Er schreibt selbst. Gottesfürchtigkeit braucht er in der Wüste nicht. Er maßt sich Gottesstatus an und bekommt ihn schließlich auch. Als er gezwungen ist, wie ein Gott zu walten - also Leben zu geben und Leben zu nehmen - wie ihm zum ersten Mal bewusst, was es heißt, ein Gott zu sein. Er liebt es und schreckt vor sich selbst zurück. Es sind solche Momente des Größenwahns, die den Narzissten Lawrence auf den Boden holen könnten - zumindest zeitweise. Denn Erfolge beflügeln Lawrence immens. Er fühlt sich göttlich, er fühlt sich unbesiegbar und macht sich auf, die Leistungen von Moses und Konsorten nachzuahmen. Bis er wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wird und wie ein Geist durch die Wüsten wandelt. Er hat den Tod gesehen, er hat den Tod bedingt, er hat ihn gefühlt, ausgeführt. Konsequenterweise wird Lawrence am Ende seines ersten Trips in die Wüste aus der Ferne angeschrien: „Wer bist du?“ Lawrence weiß es nicht.
David Lean knallt hier Bilder auf die Leinwand, von denen vorher niemand zu träumen wagte und die seitdem viele Filmemacher inspiriert haben. Sei es der Match Cut, sei es die Fata Morgana oder das riesige Schiff in der Wüste. Wichtig ist, dass die visuelle Kraft keinen Selbstzweck erfüllt, sondern stets im Dienste der Geschichte steht. Lean bleibt clever darin, den Heldenstatus von Lawrence als Hülle zu inszenieren. Der junge (selbsternannte) Gott, der über die gekaperte Eisenbahn stolziert und in der goldenen Sonne glitzert. Dass der Krieg keinen Platz für Götter und Helden hat, wird Lean seiner Hauptfigur noch eintrichtern. Der Krieg hat kein Verständnis für beide; er ist vielmehr die reine Antithese zu ihnen. Das muss auch der Reporter verstehen, der Lawrence begleitet, um die amerikanische Bevölkerung mit seinen Berichten auf den Krieg einzustimmen. Die Soldaten schießen mit ihren Gewehren, der Reporter mit seiner Kamera. Alle Schützen haben zerstörerische Ziele. Für Lean ist der Krieg auch immer ein zutiefst männliches, weil verbohrt stolzes Machtgehabe. Ein Abgrund der Menschlichkeit. Nicht im Grausamen, sondern im Erbärmlichen. Lieber wird das Wasser in den heißen Sand gegossen, als dass er die Kehlen der Andersgesinnten herunterlaufen darf. Es reicht nicht, dass man gewinnt. Die anderen müssen zerstört werden.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org