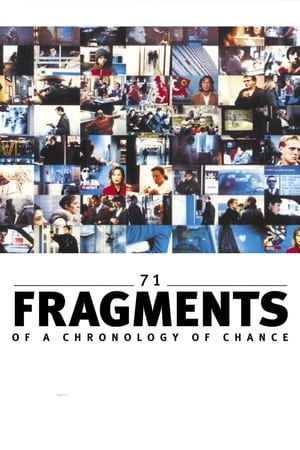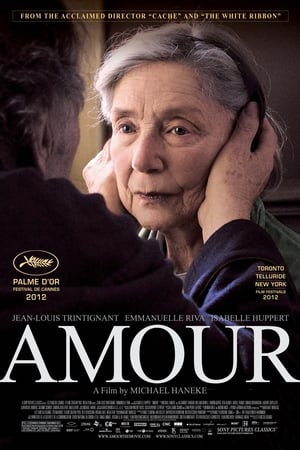Der siebente Kontinent. Allein der Titel weckt bereits Assoziationen, die der Film freilich niemals einlösen kann. Erst recht dann nicht, wenn man weiß, dass es sich dabei um den allerersten Kinofilm von Michael Haneke (Die Klavierspielerin) handelt. Denkt man jedoch darüber nach, warum ein Titel, der so unweigerlich an eine ferne, mysteriöse und vielleicht gar abenteuerliche Welt erinnert, uns auf Anhieb so fasziniert, dann kommt man der Angelegenheit schon einen Schritt näher. Auch die Ehepartner Georg und Anna werden von einer solchen Welt – oder vielmehr der Hoffnung dadurch ihrem alltäglichen Trott zu entkommen – angezogen. Nur ist ihr Fluchtpunkt nicht etwa der Titel eines Films, sondern das Plakat eines ganz und gar unwirklich anmutenden Strandes, der sich zumindest der knallroten Aufschrift nach, in Australien befinden soll. Aber letztlich ist es doch einerlei, ebenso wie das Foto unter der Sonnenblende im Auto. Ein Symbol für eine unerreichbare Hoffnung, die man nur ihrer selbst willen am Leben erhält.
Warum sich die beiden überhaupt nach einem anderen Leben sehnen, muss zu Beginn erst einmal verhandelt werden. Schließlich geht es ihnen besser als einem Großteil aller anderen Menschen. Ihre Ehe ist intakt, ihre gemeinsame Tochter Eva ist gesund und auch finanziell sind sie mehr als abgesichert. Sie personifizieren den oberen Mittelstand einer westlichen Wohlstandsgesellschaft und fügen sich dadurch erstaunlich gesichtslos in die Masse. Als Triptychon inszeniert, zeigt der Film drei Ausschnitte im Leben der Familie. 1987 als ausführlichen Einblick in ihr Leben. 1988, in dem erste Risse spürbar werden. Und letztlich 1989 als jenen Schlag in die Magengrube, den man von Haneke nur zu gut gewöhnt ist. Dazwischen, wie so oft, Ratlosigkeit, Irritation und Unverständnis. Einmal mehr liegen die Menschen auf Hanekes Seziertisch und der macht sich gewissenhaft daran, sie feinsäuberlich zu zerlegen.
Dabei passiert über weite Strecken zunächst herzlich wenig. Sechs Uhr morgens, der Wecker klingelt. Es folgt der Gang ins Badezimmer, Zähneputzen, eine Tasse Kaffee und der Weg zur Arbeit. Alltag eben, all die Tätigkeiten, die auch wir in unserem täglichen Trott verrichten, ohne dabei schon wirklich wach zu sein. Diesen Bezug zum Zuschauer hält Haneke sehr lange aufrecht, indem er nie ihr Gesicht, sondern nur einzelne Teile ihres Körpers zeigt. Eine Hand am Türgriff, eine Schulter von hinten oder ein Fuß am Bettende. Und weil es eben Haneke ist, der das alles in Szene setzt, befürchten wir auch in jedem Moment die kalte Hand des Todes, welche die Familie in ihr Unglück stürzt. Doch die bleibt zunächst aus, denn wenn man von Haneke etwas erwarten kann, dann, dass er unsere Erwartungen nicht erfüllt.
Und so nehmen wir an der täglichen Routine der Familie teil. Aufstehen, Arbeiten, Abendessen, Fernsehen. Zwischen beruflichem Aufstieg, Problemen in der Schule und dem wöchentlichen Einkauf im Supermarkt scheint kein Platz zum Leben. Immer stärker offenbaren sich die profillosen Figuren als Gefangene im System. Ein Leben nach Maßstab, Anleitung und gesellschaftlichen Vorgaben. Warum sollte man sich beschweren? Schließlich hat man doch alles. Doch hinter diesem Gefühl, welches Haneke selbst so treffend als emotionale Vergletscherung beschreibt, liegt eine tiefere Sehnsucht. Danach etwas zu erleben, etwas aus seinem Leben zu machen und auszubrechen. Doch jeder Versuch ist zwecklos, weil es keinen Platz gibt, an den sie fliehen könnten und das Leben selbst ihr Gefängnis ist.
Wie festgefahren die Familie in ihren aufgebundenen Zwängen ist, zeigt sich erst zum Schluss. In einer Orgie der Zerstörung wollen sie zunächst ihren kompletten Besitz vernichten und dann sich selbst Töten. Wir müssen systematisch vorgehen, heißt es dabei. Selbst in Augenblicken der puren Anarchie sind sie Gefangene. Die folgenden Szenen sind dann so etwas wie ein deutscher Gegenentwurf zum Finale von Zabriskie Point. Nur ist Haneke weder Hippie noch Punk und sieht darin eben keine Schönheit und Befreiung, sondern nur noch mehr Schmerz und Leid. Wenn dann am Ende eine tote Familie vor dem flackernden Fernseher sitzt, dann bringt schon der erste Kinofilm des Österreichers die Essenz seines Schaffens auf den Punkt. Einmal mehr ist der Regisseur mehr Pathologe denn Psychiater. Vielleicht macht das den Film so schmerzhaft.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org