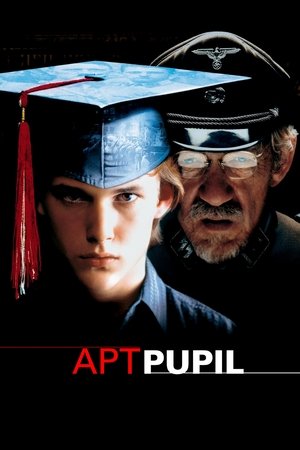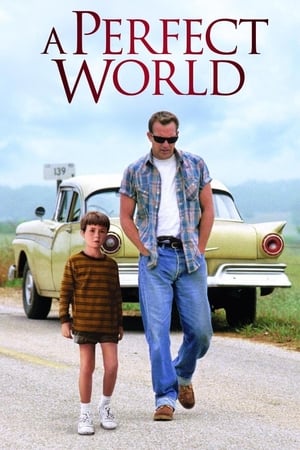Um einen solchen Sturz, wie Mel Gibson(„Payback - Zahltag“) ihn erfahren musste, abzuleisen, muss man es auch erst einmal vollbringen, derart grell am Himmel zu strahlen, wie es Mel Gibson über Jahrzehnte gelang. Zweifelsohne zählte der Australier zu den Megastars und Großverdienern des amerikanischen Kinos, nachdem er George Millers Ozploiation-Kult „Mad Max“ als Max Rockatansky seinen markanten Stempel aufdrückte. Anschließend folgte Hit auf Hit, Coverstory auf Coverstory, die Frauenwelt verzückte Gibson mit seinem naturgegebenen Charme und seinem attraktiven Erscheinungsbild, das maskuline Geschlecht befriedigte er durch seine (im doppelten Sinne) schnittige Schlagfertigkeit. Nachdem Gibson jedoch als Antisemit und christlicher Fundamentalist die Schlagzeilen der Boulevardzeitschriften füllte, kam es zur Vertreibung aus dem sonnendurchfluteten Garten Eden: In Hollywood war kein Platz mehr für Mad Mel. Aber drehen wir die Zeiger um einige Jahre zurück; zurück ins Jahr 1993.
Mel Gibson war zwar noch kein Oscar-Gewinner, aber eine hochgepriesene Persönlichkeit von Format, die nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter die Herausforderung suchte. Seine erste Regiearbeit „Der Mann ohne Gesicht“ lässt sich heute, mit Blick auf Gibsons Nachfolgewerke „Braveheart“, „Die Passion Christi“ und „Apocalypto“, die handwerklich immer herausragend, inhaltlich jedoch mindestens diskutabel waren, sagen, dass Mel Gibson ein wirklich äußerst angenehmes Debüt gelungen ist. Als Regisseur, der später für die überbordenden Gesten und den manischen Anspruch, so authentisch wie möglich zu inszenieren, bekannt wurde, zeigt Gibson mit „Der Mann ohne Gesicht“, dass er auch überaus begabt darin ist, die feinnervigen Töne zu einer sensiblen Symphonie über Freundschaft und Toleranz zu dirigieren. Hier geht es noch nicht um die historische Klitterung des Pathos wegen oder einem Ventil der persönlichen, evangelikalen Ideologie.
Im Epizentrum der kontemplativ erzählten Handlung steht Justin McLeod (Mel Gibson); ein Ausgestoßener, weil sein Gesicht zur Hälfte mit Brandnarben entstellt und die Gerüchte um seine Person unlängst abenteuerliche Ausmaße angenommen haben. Er selbst beschreibt sich scherzhaft als „Märchentroll“, während der Großteil des Küstenstädtchens in Maine ihn doch nur als „Matschbirne“ herabsetzt. Ihm wird der heranwachsende Chuck (Nick Stahl, „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“) entgegengesetzt. Zu Hause fehlt ihm die autoritäre Führung und elterliche Zuneigung, seine Mutter (Margaret Whitton, „9 ½ Wochen“) hingegen hat es zustande gebracht, drei Kinder von drei verschiedenen Männern zu gebären – und, so mutet es jedenfalls an, es ist noch lange nicht Schluss. Auch Chuck ist eine Randgestalt, nicht zuletzt aus dem Grund, weil er Ziele in seinem Leben hat, weil er nicht beim Regale auffüllen in der Provinz versauern möchte. Und das bildet den Kristallisationspunkt im Narrativ des Films: Zwei Menschen, die sich in ihrem inneren wie äußeren Ausgestoßensein zwangsläufig zusammenfinden müssen.
Ein Novum stellt Gibsons „Der Mann ohne Gesicht“ nicht dar, der Topos um eine multigenerationelle Freundschaft ist nach wie vor profitabler Bestandteil der Filmlandschaft – und wird es auch bleiben. Mel Gibson verzichtet jedoch darauf, seine Geschichte, basierend auf einem Roman von Isabelle Holland und adaptiert von Malcolm MacRury, über larmoyante Posen zu entwickeln und sucht den engen Kontakt zu seinen Hauptcharakteren, die beide auf ihre Weise (wieder) ins Leben zurückfinden müssen. Die lauten dramaturgischen Spitzen tun sich auf, wenn es um die Spekulationen des Umfelds um die Person des Justin McLeod geht: Ist er ein Pädophiler? Ein Mörder? „Der Mann ohne Gesicht“ hält dem Zuschauer dabei aber immer eine Sache gekonnt entgegen: Und wenn es so wäre, glaubst Du nicht, anhand des Gesehenen, dass eine Läuterung im Bereich des Möglichen liegt? Eine zweite Chance ist eine Frage der Toleranz, die die dunklen Wolken oberhalb der Kleingeistigkeit vertreiben, auch wenn dafür ein Lebewohl manchmal der einzige Weg scheint.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org