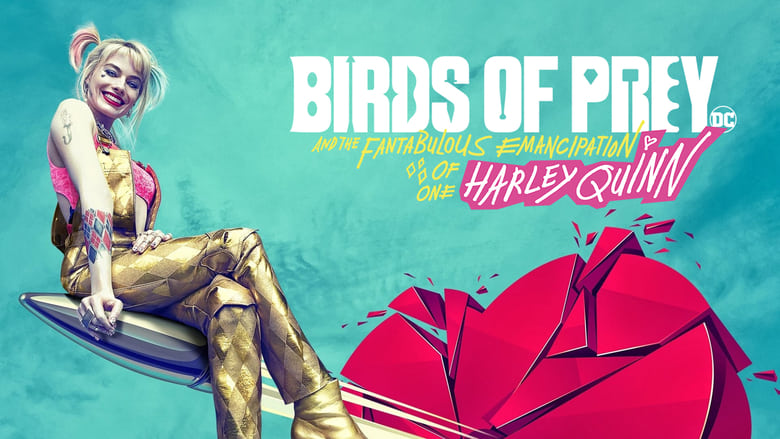In den Zeiten der großen Filmfranchises ist es für eine_n Darsteller_in vergleichbar mit einem Sechser im Lotto, wenn er oder sie eine bekannte wie beliebte, wiederkehrende Rolle innehat. So gesehen ist es wenig verwunderlich, dass Margot Robbie (frisch Oscar nominiert für Bombshell - Das Ende des Schweigens) nach Suicide Squad der Figur der Harley Quinn die Treue hielt. Dass ihre Darstellung der durchgedrehten Dr. Harleen Frances Quinzel (so der bürgerliche Name) eine der wenigen Facetten des DC-Films war, die durchweg positive besprochen wurde, dürfte mit dafür gesorgt haben, dass sie sowie das Studio weiter an der zöpfetragenden Anarchieprinzessin festgehalten haben. Überhaupt versuchen Warner und DC aktuell mit einer Mischung aus „dran bleiben“ und „Wenn's nicht passt, wird's passend gemacht“ ihr cineastisches Helden- und Schurkenuniversum irgendwie zu retten. Bislang erweist sich diese Taktik als erfolgreich, auch wenn die Kontinuität dabei oft und gerne riesige Purzelbäume schlägt.
Aber vielleicht ist es gerade dieses Fehlen einer Stringenz, die dafür sorgt, dass die DC-Filme zwar nie den Beliebtheitswert der Marvel-Konkurrenz erreichen, dafür sind die Werke von Warner, selbst wenn sie mit Pauken und Trompeten scheitern, immer interessanter als das, was uns das MCU mit enormer Beständigkeit serviert. Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn ist nicht gescheitert. Nicht alles passt zusammen, nicht alles funktioniert, aber Margot Robbie, die Birds of Prey mit ihrer Firma Luckychap mitproduzierte, Regisseurin Cathy Yan (Dead Pigs) und Drehbuchautorin Christina Hodson (Bumblebee) haben insgesamt einen Film auf die Beine gestellt, der als Entschuldigung für Suicide Squad genauso gut da steht, wie als eigenständige Zelebrierung für die Figur der Harley Quinn.
Visuell erinnert Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn an Suicide Squad. Die Farbregler wurde allerdings bis auf Anschlag gedreht, die wilden Texteinblendungen werden etwas besser und reduzierter eingesetzt und die Wahl der Songs wirkt nicht mehr so faul und schematisch. Auch der Schnitt, wahrlich die Achillesverse des Selbstmörder-Teams, überzeugt dieses Mal. Mit 108 Minuten ist Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn dazu für eine Comicverfilmung erstaunlich kurz, wobei klar gesagt werden muss, dass der eigentliche Plot vermutlich gerade einmal ausgereicht hätte, um einen Kurzfilm zu füllen. Gestreckt wird die simple Geschichte durch die Narration.
Harley Quinn springt durch ihre subjektive Erzählung nämlich munter in der Zeit umher, dehnt Beiläufigkeiten aus und kommentiert selbstverständlich viele der Ereignisse, die auf die Leinwand projiziert werden, auf ihre Art und Weise: naiv, narzisstisch, anarchisch, verrückt. Wem das liegt, wird eine Menge Spaß haben mit der Erzählweise, die ganz klar an Deadpool erinnert und genau wie dort nicht wirklich sicher ist vor Abnutzungserscheinungen. Diese treten auch bei der Figur Harley Quinn selbst auf. Insgesamt ist die Antiheldin nämlich ziemlich unsympathisch, was nicht schlimm wäre, wenn ihre Entwicklung weitestgehend nicht recht eintönig ablaufen würde. Für solch eine anarchische Figur wirkt ihre charakterliche Entfaltung schon sehr systematisch. Hier gehen die Macher leider auf Nummer sicher und trauen sich nicht aus dem Korsett auszubrechen. Echte Überraschungen tauchen in Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn also nicht auf.
Achtung! Der nächste Absatz enthält zwei Mini-Spoiler.
Nicht auftauchen tun dafür Batman und der Joker. Gut so, denn der Film erzählt vor allem im ersten Akt von Harley Quinns Emanzipation vom Joker. Aber egal wie wild, explosiv und durchgedreht die Produktion diese Loslösung durchgeführt hätte, dass alles wäre in den Schatten gekrochen, wenn plötzlich die zwei Alphatiere von Gotham die Szenerie betreten hätten – selbst wenn es nur für den einen oder anderen Gastauftritt gewesen wäre. Natürlich ist vor allem der Joker immer wieder Thema im Film, doch das Script versucht unmissverständlich klar zu machen, dass Harley Quinn hier und jetzt die klare Nummer eins ist, auch wenn das bedeutet, dass die titelgebenden Birds of Prey ganz klar nur die zweite Geige spielen und eigentlich erst im Showdown wirklich eine Wertigkeit erhalten.
Das ist durchaus schade denn Jurnee Smollett-Bell (The Defenders) als Black Canary, Rosie Perez (The Dead Don't Die) als Renee Montoya und Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane) als Huntress gelingt es gut ihre rudimentären Figuren mit Leben zu füllen. Dafür, dass sie von der Persona Harley Quinn inszenatorisch wie narrativ in die Ecke gedrängt werden, liefern sie alle ein durchaus überzeugende Leistungen ab. Black Canary hat vermutlich sogar die beste Actionszene im Film. Warum? Weil sie dort, in einem Hinterhof, wirklich wirkt, als würde sie um etwas kämpfen. Sie muss einstecken und austeilen, ganz anders als Harley Quinn. Wenn diese sich prügelt, ist das zwar wunderbar stylish in Szene gesetzt, es wirkt aber auch mehr wie eine auswendig gelernte Tanznummer. Schön anzusehen, aber irgendwie verpufft die Kraft zu schnell. Dennoch ist gerade bei den Kampfszenen klar zu erkennen, dass John Wick-Regisseur Chad Stahelski mit an Bord war, allerdings wurden die Kopfschüsse gegen nicht-tödliche aber dennoch sehr schmerzhafte Glitzereruptionen ausgetauscht.
Trotz fehlender Kopfschüsse hat sich Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn seine FSK16-Freigabe verdient. Teilweise überraschend brutal geht es hier zu Werke. Kein Schlachtfest mit einem Kunstblutverbrauch im Hektoliterbereich, aber dennoch erlaubt sich Regisseurin Yan hin und wieder die ein oder andere Sauerei zu präsentieren. Wobei in den USA wohl vor allem der inflationäre Gebrauch des bösen F-Worts für das R-Rating gesorgt hat. Hier wäre aber weniger vielleicht doch etwas besser gewesen, denn oft genug wirken die Mono- wie Dialoge schon etwa borniert auf cool und 'erwachsen' getrimmt.
Das ändert aber nichts daran, dass die Darsteller mit viel Verve zu Werke gehen. Herausstechend dabei ist neben Margot Robbie, die sich die Rolle wirklich zu eigen macht, Ewan McGregor (Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachen). Dieser darf als Black Mask herrlich überdreht aufspielen. Zwar bleibt seine Figur in Sachen Motivation und Stellenwert immer etwas schwammig, das ändert aber nichts daran, dass es einfach nur verdammt viel Spaß macht ihm dabei zuzusehen, wie er den weltmännischen und dennoch eiskalten mimt. Auch sein Psychokiller-Sidekick Victor Zsasz (Chris Messina, Live By Night) hilft dabei, dass die Schurken in Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn nicht wie austauschbares Flickwerk wirken, um die notdürftige Geschichte am Laufen zu halten – auch wenn sie das letztlich sind.
Abschließend noch eine Frage: Wo ist Gotham? Seit dem Christopher Nolan der Welt von DC 2005 mit Batman Begins ein neues filmisches Leben einhauchte hat die kultige Stadt ihre Identitiät verloren. New York, Chicago, San Francisco oder wie im Falle von Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn Los Angeles. Das ist nun Gotham. Unglaublich schade. Es wird Zeit Gotham wieder zu einer düsteren, einmaligen Metropole zu machen. Hoffentlich gelingt dies The Batman, der im Sommer 2021 in die Kinos kommen soll. Gebt uns endlich wieder ein echtes, bzw. ein unechtes Gotham zurück!
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org