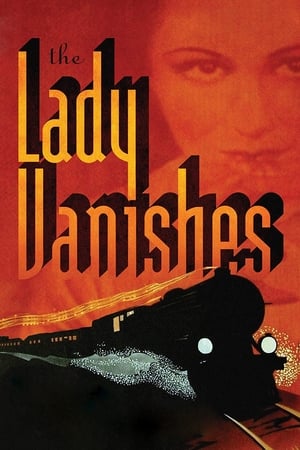Es ist einfach und naheliegend (deshalb lange noch nicht immer angebracht), bei einem Suspense-Thriller aus dem Jahr 1956 reflexartig den Hitchcock-Vergleich zu bringen, doch bei „23 Schritte zum Abgrund“ fast unweigerlich. Als Ritterschlag. Wenn der dicke Alfred in dieser Zeit nicht eh so (positiv) umtriebig gewesen wäre, man könnte ihm fast vorwerfen, dass ihm hier ein Skript durch die Lappen gegangen ist. Von seinen Ambitionen ist das exakt seine Baustelle und was extrem erfreulich ist, sogar das Resultat entspricht dem, was seine guten (nicht genialen) Filme immer auszeichnete.
Von Hollywood-Routinier Henry Hathaway („Die vier Söhne der Katie Elder“) abgeklärt (und wunderbar fotografiert) in Szene gesetzt, kann sich dieser Film schon früh vom Einheitsbrei des Genres absetzen, durch einen eigentlich ganz simplen, dafür sehr geschickt installierten Move, der die gesamte Essenz der folgenden 100 Minuten auf den Punkt bringt: Es gibt immer ein Für und Wieder. Ein Handicap ist – schon von der Definition des Wortes – eine Einschränkung, aber es kommt auf die Umstände an. Unter bestimmten Voraussetzungen muss dieses gar nicht auffallen, kann sogar – so merkwürdig das klingen mag - von „Vorteil“ sein, stellt einen schlussendlich aber immer vor Hürden, die sich nicht wegdiskutieren lassen. In den ersten Minuten des Films dürfte wohl keinem Zuschauer auffallen, mit welchem Schicksal Protagonist Phillip (Van Johnson, „Deine, meine, unsere“) hadert, bis es gestartet durch eine „Slapstick“-Szene kurz darauf wie Schuppen von den Augen fällt: Er ist blind. Was tatsächlich überrascht, in seinen eigenen vier Wänden ist er stets Herr der Lage, preist seiner Ex-Verlobten Jean (Vera Miles, u.a. „Der falsche Mann“ und „Psycho“, allein deshalb riecht es dezent nach Hitchcock) sogar die wunderbare Aussicht von seinem Balkon über London an, deutet auf die Sehenswürdigkeiten, obwohl er sie selbst nie gesehen hat.
Erst außerhalb seines geschützten Rahmens könnte sein Zustand ins Auge springen, doch selbst dort bewegt sich der stolze Mann so erprobt, dass es nicht unbedingt der Fall sein muss. Von ihm bewusst gelenkt, denn er will kein „Krüppel“ sein, nicht als hilfebedürftig wahrgenommen werden. Er hat sich in seiner luxuriösen Wohnung eingeigelt, alle Verbindungen zu seinem früheren, unbeschwerten, „normalen“ Leben gekappt, ergibt sich praktisch seinem Schicksal, obwohl er es sich selbst nicht eingestehen will. Bis er – auf der Flucht vor der Konfrontation mit seiner Vergangenheit, verkörpert durch Jean – in einer Bar ein Gespräch mitverfolgt. Eine Konversation, wie sie jeder andere wohl kaum wahrnehmen würde, beiläufig in einem Séparée geführt, von den sonstigen Eindrücken maximal als Wortfetzen unterdrückt. Er versteht Wort für Wort, nur gestört durch den aufdringlichen Lärm eines Spielautomaten. Er belauscht, mehr oder weniger unfreiwillig, die Planung eines Verbrechens, wahrscheinlich einer Kindesentführung. Nimmt sogar den prägnanten Geruch eines der Beteiligten wahr. Seine verbliebenen Sinne haben sein Augenlicht ersetzt, was ihm hier zu Gute kommt. Auditiv, olfaktorisch und kognitiv nimmt er Impressionen auf, die sonst untergehen würden. Kann sie verarbeiten, das Gespräch sogar bis ins Detail wiedergeben und sich mit Indizien an die Polizei wenden, doch die sehen das Ganze nüchtern, sicher auch durch seine Behinderung beeinflusst eher skeptisch. Die überreaktionäre Spinnerei eines armen Mannes.
„23 Schritte zum Abgrund“ ist (nicht nur) deshalb so gut, da er die Blindheit seiner Hauptfigur nicht als reinen, plumpen Aufhänger missbraucht, sondern sie zur schlüssigen, sogar psychologisch konsequenten Figuren- und Plot-Entwicklung nutzt, dabei beide Seiten der Medaille beleuchtet. Phillip ist kein „Daredevil“, kein Superheld, kann aber mehr registrieren und nutzen als wir, die uns zu sehr auf die Sehkraft verlassen. Im Gegenzug braucht er Hilfe in gewissen Momenten, die in teilweise brisante Situationen gipfeln, denn letztlich fehlt ihm doch ein nicht unwichtiger Sinneseindruck. Besonders mit diesem Auf und Ab spielt „23 Schritte zum Abgrund“ sehr geschickt, was auch in der Kulisse des nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht vollständig wiederaufgebauten Londons speziell in einer Szene Verwendung findet. Die gesamte Handlung wäre mit einem sehenden Protagonisten nicht denkbar, sowohl im Positiven, wie im Negativen. Beide Aspekte halten sich die Waage, ohne dass sie überstrapaziert oder zu konstruiert, klischeehaft wirken. Exakt dadurch entwickelt der Film erst seine präzisen Höhepunkte, mal abgesehen von dem ohnehin spannenden Plot, der sich – wie es sich gehört – erst zum Ende in die Karten schauen lässt.