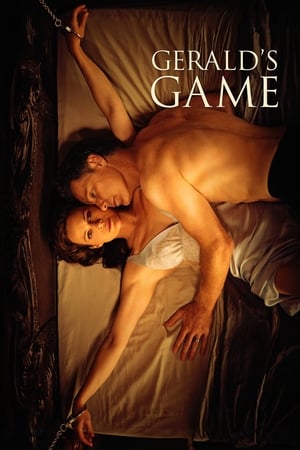„Würde ich mich jetzt hinknien, würde Gott mich erschlagen.“
Die sehr markante, sehr detaillierte und sehr bildliche Schreibe von Stephen King wird immer als eine beschrieben, die sich wunderbar dafür eignet, für die große Leinwand adaptiert zu werden. Obgleich es nicht zu leugnen ist, dass die Romane von Stephen King in der Regel sehr greifbare Gedankenhorizonte freilegen, so erweist sich eine King-Verfilmung im Lichtspielhaus dann doch mit überraschender Kontinuität als gescheitert. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Erzählerisch sind Film und Literatur eben doch zu unterschiedliche Medien, als dass sie eine reibungslosen Übergang untereinander für selbstverständlich erklären könnten. Dass hat sich in diesem Jahr gleich mehrfach bewiesen. Angefangen mit dem enttäuschenden Es, bei dem Andy Muschietti (Mama) konsequent an der Essenz der Vorlange vorbei inszenierte und gefolgt von der Netflix-Produktion Das Spiel mit Carla Gugino, die nicht schlecht war, aber mit ungeheuren Pacing-Defiziten zu ringen hatte.
1922, ein verhältnismäßig unbekanntes Werk aus der Novellensammlung Zwischen Nacht und Dunkel, ereilt nun dasselbe Schicksal wie Das Spiel vor einigen Wochen. Nicht nur handelt es sich hierbei ebenfalls um ein Netflix Original, 1922 ist gleichwohl kein schlechter Film, vollbringt es aber nicht, den Zuschauer über seine gut 100-minütigen Laufzeit konsequent in seinen Bann zu ziehen. Wer sich schon einmal in einem Buch von Stephen King verloren hat, weiß, wie eng das Band ist, welches der ikonengleiche Wortschmied zwischen seiner Prosa und dem Leser knüpft. Jene immersive Strahlkraft ist in 1922 im ersten Drittel der Handlung ebenfalls zu vernehmen, erweckt Regisseur und Drehbuchautor Zak Hilditch (These Final Hours) doch den Eindruck, als würden er die literarische Inspirationsquelle gekonnt auf das Wesentliche eindampfen (dass Stephen King sich selber gerne reden hört, ist weitreichend bekannt).
Ja, 1922 möchte schnell auf den Punkt kommen, wenn er den innerfamiliären Konflikt der James' (besetzt mit Thomas Jane, Molly Parker und Dylan Schmid) recht zügig eskalieren lässt. Wilfred (Jane, The Punisher) hat nichts übrig für den Trubel der Großstadt, während sich Arlette (Parker, The Road) dem Landleben überdrüssig zeigt. Mit dem Erbe ihres Vaters möchte sie der Provinzialität entkommen – was Wilfred, der das solide Dasein samt tagtäglicher Knochenarbeit vollkommen in sich aufgenommen hat, zum Mordanschlag zwischen wird. Spielball zwischen den Fronten ist Sohnemann Henry (Schmid, Horns), den Wilfred gezielt gegen seine Mutter aufwiegelt. All das behandelt Zak Hilditch in der ersten halben Stunde des Films und könnte somit die Grundpfeiler für eine Meditation über die Macht von falschem Stolz, die so manch radikale Blühte treibt, und die innerseelische Gewalt von Schuld, die nicht minder Leben nehmen kann, legen.
Allerdings ist 1922 ein Film, dessen Gelingen in den Ansätzen steckenbleibt. Ohne Zweifel, gerade durch die famose Performance von Thomas Jane, der hier das knorrige Abbild eines Amerikas verkörpert, in dem Männlichkeit die erste Geige spielt, gibt 1922 oftmals mehr Tiefe, als es die Inszenierung seitens Zak Hilditch verantworten könnte. Hilditch mag sich ungemein versiert darin verstehen, allegorische Bildwelten zu erschaffen, wenn er den inneren Kampf von Wilfred nach außen kehrt. Inhaltlich aber bleibt 1922 ein Werk der Verschlagwortung, was vor allem durch den Off-Kommentar unterstrichen wird. Dabei hätte diese Auseinandersetzung mit Schuld und ersehnter Sühne nicht nur als klassische Geistergeschichte funktioniert, die das Übernatürliche als Spiegel der Seele begreift, sondern auch als Charakter-Drama, das simultan das Porträt einer Nation zeichnet, welches bereit ist, über Leichen zu gehen, um das eigene Hab und Gut zu wahren.
Und dieses 'Wahren' darf sich gerne als 'Verteidigen' verstehen lassen. Notfalls eben auch gegen die eigene Familie. Es wäre, in der Theorie, also eine Geschichte gewesen, die sich mit der Last, Blut an den Händen zu haben, beschäftigt hätte. Und: Mit dem Fluch, jenes Blut zu vererben. Zak Hilditch jedoch bleibt weitestgehend oberflächlich und phlegmatisch, gibt sich als audiovisuell kompetenter Filmemacher zu erkennen – ohnehin sieht 1922 wirklich blendend aus -, besitzt jedoch wenig Gespür dahingehend, dem Gewissen der Charaktere auf den Zahn zu fühlen. Den Geist von Arlette, der Wilfred irgendwann nicht nur in der Nacht, sondern auch bei Tage heimsucht, nicht nur in die Mechaniken des konventionellen Genre-Kinos einzuweben (wie das funktioniert hat beispielsweise Alfred Hitchcock in Rebecca bewiesen). Selbstredend reicht es auch nicht aus, Wilfred die Erkenntnis formulieren zu lassen, dass Mord nicht nur Verdammnis sei, sondern auch Arbeit. 1922 ist zu statisch.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org