Ein Klassiker ist nicht einfach nur ein Kind seiner Zeit. Es ist kein Film, der nur in einem bestimmten zeitlichen respektive kulturellen Kontext funktionieren kann. Ein echter Klassiker geht zwangsläufig über sein Entstehungsjahr hinaus und zeichnet sich, neben seiner Interkulturalität, durch das wohl größte Attribut aus, dem ein Film anheim fallen kann: Durch seine Zeitlosigkeit. Sprich, ein Klassiker, der sich diesen hochrangigen Status auch verdient hat, begeistert damals wie heute und besitzt schlicht kein erkennbares Verfallsdatum. Es lässt sich natürlich trefflich darüber streiten, inwiefern sich ein Film aus den – rein exemplarisch – 1940er Jahren noch mit den Sehgewohnheiten dieser Tage vereinen lässt; im Kern, über seine formalen Erzähl- und Darstellungsmittel hinaus, aber bleibt die Faszination. Stanley Kramer („Rat mal, wer zum Essen kommt“), der bei seinen Regiearbeiten auch immer den Posten des Produzenten bekleidet hat, kennt sich zu genüge mit Klassikern aus.
Neben dem versöhnlichen, für zehn Oscars nominierten „Rat mal, wer zum Essen kommt“, der die Rassenproblematik im großbürgerlichen Milieu der US-Gesellschaft in den 1960er Jahren behandelte, hat Kramer durch seine saubere Schauspielführung ebenfalls dafür gesorgt, dass Maximilian Schell für seine Performance als Hans Rolfe im überlangen Gerichtsfilm „Das Urteil von Nürnberg“ (1961) mit dem Academy Award honoriert wurde. Aber der Klassikerhunger des Œuvres von Stanley Kramer zeigt sich damit noch nicht gestillt. Mit „Wer den Wind sät“ (1960) hat sich Kramer schon ein Jahr vor „Das Urteil von Nürnberg“ dem Gerichtsfilm angenommen und Großartiges abgeliefert. Basierend auf dem sogenannten „Scopes-Affenprozess“ des Jahres 1925, bei dem sich ein Lehrer die Freiheit herausgenommen hat, die Darwin'sche Evolutionstheorie, entgegen des Gesetzes, an einer Schule zu lehren. Das Gesetz, der Bibel in Bezug auf die Entstehungsgeschichte nicht widersprechen zu dürfen, wurde im gleichen Jahr wieder abgeschafft – der Medienrummel war enormen Ausmaßes.
Elementar für das Gelingen von „Wer den Wind sät“ ist der Umstand, dass sich das Drehbuch auf keine Seite der ausschlaggebenden Oppositionen schlägt. Es geht hier nicht darum, ein allgemeingültiges Ergebnis beim Namen zu nennen und damit entweder den Kreationismus oder doch eher den Darwinismus in die Ecke zu drängen und damit zu denunzieren. „Wer den Wind sät“ appelliert an eine Lebensrealität, in der jeder Mensch die Freiheit besitzt, das zu glauben und zu äußern, was er für sich persönlich am geeignetsten empfindet, gleichwohl aber akzeptieren muss, dass naturwissenschaftliche Erkenntnisse den gleichen Stellenwert genießen, wie die der Bibel destillierte Offenbarungsweisheit: Die „fundamentale Wahrheit“ der Schöpfungsgeschichte muss sich in einer gesunden Gesellschaft mit Darwins Evolutionstheorie die Waage halten. Im Mittelpunkt stehen hier der Agnostiker Henry Drummond (Spencer Tracy) und der Evangelikale Matthew Harrison Brady (Fredric March). Zwei ehemalige Freunde, doch ihre Beziehung wurde einst durch Bradys Fanatismus zerrüttet.
Nun stehen sie sich im Gerichtssaal gegenüber. Während Drummond die Vernunft bestürmt, artikuliert sich Brady fortwährend in Bibelrhetorik, setzt den Glauben über das Wissen, den Geist über Bauch und Intellekt. „Wer den Wind sät“ lebt von seinen pointiert geschriebenen Dialogsequenzen: Worte wie Pistolenschüsse feuern durch den Raum; Bonmots, die in ihrer überzeitlichen Prägung wie ein Echo in der Ewigkeit wirken. Um den Prozess herum erhitzen und verhärtet sich in dem kleinen Städtchen Hillsboro, Tennessee die Fronten. Dabei liegt die Lösung so nahe: Jeder Mensch sollte Herr darüber sein, wem er nun ein Denkmal errichtet. Vor allem Brady wird im Verlauf der Geschichte zu einem Charakter, der eine gewisse Traurigkeit mit sich trägt; bei dem schnell ersichtlich wird, dass ihm bis auf seinem Glauben nichts geblieben ist, an dem sich sonst aufrichten kann. Wenn der von Gene Kelly gespielte E.K. Hornbeck angesichts einer demonstrierenden Meute die Aussage fällt, dass „solche Dummköpfe unsere Gesetze machen“ und genau diese Leute „der Fluch der Demokratie“ seien, ist das nicht per se den Gläubigen gerichtet, sondern denjenigen, dessen Bibeltreue jedwedes eigenmächtiges Denken vollkommen ausgeschaltet hat.
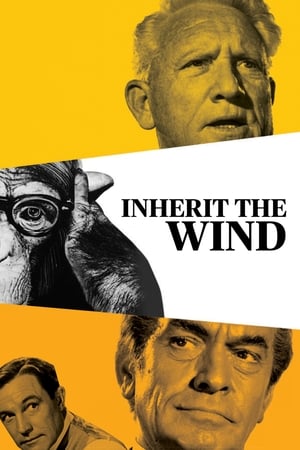 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org
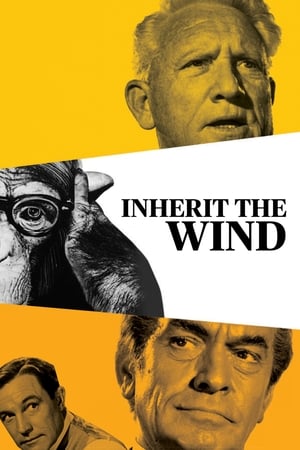







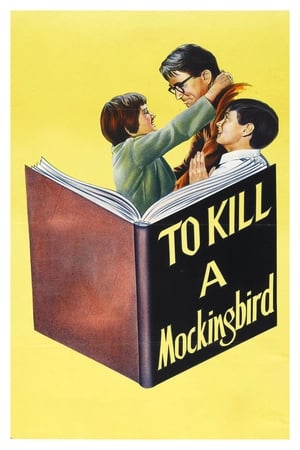

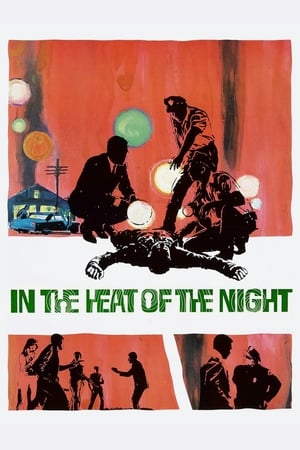
Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!