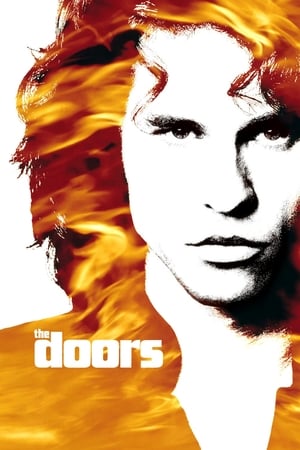Wohl nur Elvis Presley und Michael Jackson spielen (als Einzelpersonen) von ihrer Relevanz in der selben Liga der US-amerikanischen Musikgeschichte wie Johnny Cash (1932-2003). Der Rebell der Country-Szene; das Idol der Ausgestoßenen, Fallengelassenen und Unverstandenen; die wütende, rotzige Stimme des kleinen Mannes, der auch als Superstar immer so nah am Boden kleben blieb, dass der Absturz deutlich näher war als die Sterne, zu denen er hätte aufsteigen können. Ein bewegtes, ein eigentlich katastrophales Leben, dem James Mangold (Logan – The Wolverine) mit Walk the Line - dem Titel eines seiner ersten, großen Hits und gleichzeitig eine Metapher für den bipolaren Charakter des Künstlers – ein filmisches Denkmal setzt, das dem Man in Black in weiten Teilen sehr gerecht wird, auch wenn es ihm nicht gelingt, alle Facetten seiner abenteuerlichen und zu tiefst bitteren Biographie im angemessenen Umfang zu erfassen. Wobei das einer kaum zu stemmenden Mammutaufgabe gleichkommen würde. Selbst der Extended Cut mit seinen 153 Minuten kann nur einen Teilabschnitt darbieten und verzichtet schon auf so viele wichtige, charakteristische Episoden, die das Gesamtwerk allerdings erst richtig rund gemacht hätten.
Es beginnt dort, wo nicht nur chronologisch der Starpunkt liegt, sondern der Mensch wie der Künstler Johnny Cash durch ein traumatisches Erlebnis für immer geprägt wird. Der qualvolle Unfall-Tod seines heiß geliebten, älteren Bruders, für den sich der Junge immer die Schuld gab – sie ihm sogar ganz unverblümt von seinem Vater gegeben wurde. Er zog sich zurück, wurde vom lebensfrohen Kind zum introvertierten Außenseiter, begann zu rauchen und war fortan – ohne es sich direkt eingestehen zu wollen – immer darauf erpicht, sich selbst zu bestrafen und selbst langsam zu zerstören. In Selbstmitleid- und hass zu zerfließen, was aber eher als schleichender Prozess stattfand. Und was ausgerechnet dazu führen sollte, dass er zu einem der wichtigsten Musiker seiner Zeit wurde. Walk the Line versteht die immense Prägnanz dieses Schlüsselerlebnisses und baut darauf den gesamten Plot auf, ohne unnötig erklärend immer wieder darauf hinweisen zu müssen. Das vom Tod des Bruders zum Wehrdienst in Deutschland in einem Wimpernschlag gesprungen wird, ist kein Zufall oder erzählerischer Zeitnot geschuldet. Hier erwirbt er seine erste Gitarre, bringt sich autodidaktisch das Spielen bei und entwickelt den Stil, schreibt die ersten Texte, die ihm später der großen Durchbruch ermöglichen.
Zurück in der Heimat – verheiratet, junger Familienvater und mit einem schlecht bezahlten Von-Tür-zu-Tür-Vertreter Job gestraft -, wird er fast magisch angezogen von diesem kleinen Plattenstudio. Wo er und seine zwei Amateur-Bandkollegen mit Gospel-Songs vorspielen und gnadenlos abgeschmettert werden, bis Cash sein wahres, melancholisches und wehmütig-klagendes Ich in Form seiner frühen Werke zum Vorschein bringt. Der Rest ist Geschichte. Ein kometenhafter Aufstieg folgt, mit allen fatalen Nebenschauplätzen, die so eine getriebene, destruktive Person kaum vermeiden kann. Drogen, Suff, Bestätigung beim Seitensprung, das Vernachlässigen der eigenen Familie. Alles mit einer Inbrunst und Unvernunft, dass man ihm Absicht bei der Selbstdemontage des Glücks unterstellen müsste, was er sich hart erarbeitete und eigentlich behüten müsste wie seinen Augapfel. Das alles sind Verarbeitungsprozesse eines Jungen, der das Lachen verlernt und es durch Schwere und Selbsthass ersetzt hat. Nur das sie nicht auf eine konkrete, sichtbare Lösung hinarbeiten. Lediglich immer weiter auf den Abgrund zu kroch, wovor ihm ausgerechnet ein anderes, wenn auch nicht so arg gebeuteltes Kind, durch ihre zögerlich zu teil werdende Liebe letztendlich bewahrte.
James Mangold wählt eine der wohl spannendsten, möglichen Musiker-Biographien aus und akzentuiert die Schwerpunkte zunächst goldrichtig. Voll auf die Tristes, die Hoffnungslosigkeit und die Unfähigkeit seines Protagonisten zu setzen, Verantwortung für sein Handeln und alles um ihn herum übernehmen zu können. Und wie ihn genau das paradoxerweise zum Megastar machte. Gefeiert als Held, bei dem unglaubliches Talent und traurige Umstände sich zu einem sonderbaren Selbstläufer entwickelten. Die da draußen dachten, er erzählt über sie, gibt ihnen eine Stimme. Tatsächlich klagt ein verbitterter, verzweifelter, gebrochener Mann nur seine Depression und Unvermögen mit, sich selbst zu helfen. Cash und seine Fans, sie redeten (mindestens anfangs) eigentlich aneinander vorbei, was sich daraus entwickelte konnte niemand ahnen. Und wurde zumindest geringfügig zu einer Art Therapie, auch wenn es erst wesentlich schlimmer werden musste, bevor von einer Besserung nicht mal im Entferntesten gesprochen werden konnte.
So aufregend und zielgerichtet Walk the Line den Mensch und nicht die Kunstfigur Johnny Cash in der Vordergrund stellt und genau versteht, an welcher Wurzel er zu entschlüsseln ist, umso bedauerlicher wird es gen Ende, wenn nicht nur ersichtlich ist, wie viele eigentlich wichtige (und filmisch absolut sehenswert verwertbare) Kapitel keine Erwähnung finden, die besonders die Todessehnsucht und depressive Melancholie von Cash noch deutlicher Unterstrichen hätten, der Festigung seines Charakters zuträglich gewesen wären. Im letzten Drittel verfällt Walk the Line eindeutig der üblichen Bio-Pic-Krankheit: Zur sympathischen Synchronisation mit der Hauptfigur etwas/viel belastendes Material auslassen, das Positive wichtiger machen als es im Verhältnis war, sichtlich auf’s erzählerische Gaspedal drücken, damit es alles noch in den knapp gewordenen Zeitrahmen schafft…und letztlich fehlt immer noch so viel, da wäre noch ein (gutes) Sequel machbar. Schade, denn Walk the Line steht insgesamt weit über dem gediegenen, bitte nicht zu kritischen Biopic-Einerlei, denn er traut sich durchaus was. Zeigt seinen „Helden“ sehr angreifbar und ist nicht weniger als gesegnet mit einer unfassbaren Performance von Joaquin Phoenix (The Master).
Der spielt das nicht, der lebt das nicht, der IST Johnny Cash. Mit Leib, Schweiß und Seele. Jede Szene ist so impulsiv und authentisch, es ist beinah gespenstisch. Singen kann er auch noch, und wie. Atemberaubend. Eine Verschmelzung, das kann nicht gesund sein. Und ohne jetzt bitte die Oscar-gekrönte Leistung von Reese Witherspoon (Das Zeiträtsel) als June Carter herabwürdigen zu wollen: Das ist doch kein Vergleich. Phoenix spielt, als wäre der Teufel hinter ihm her. Wie Johnny Cash mindestens 59 Jahre gelebt hat. Als gäbe es da draußen nichts anderes. Witherspoon kopiert gut eine Person. Singt fantastisch. Aber Phoenix erschafft etwas. Der bebt in jedem Moment und Johnny Cash wäre bestimmt unglaublich stolz gewesen, sich so verkörpert zu sehen.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org