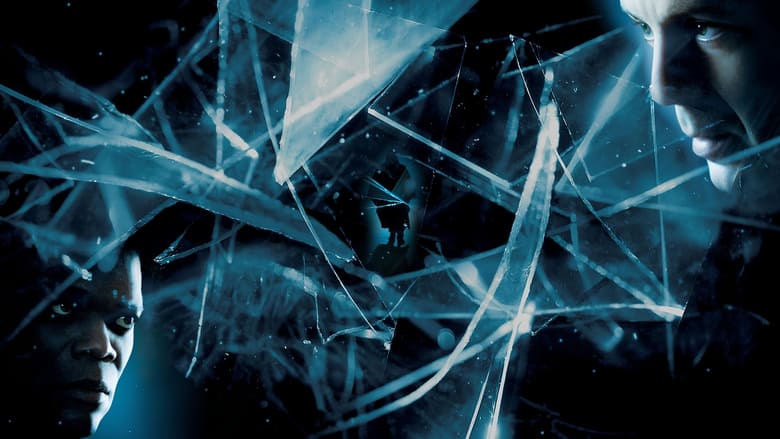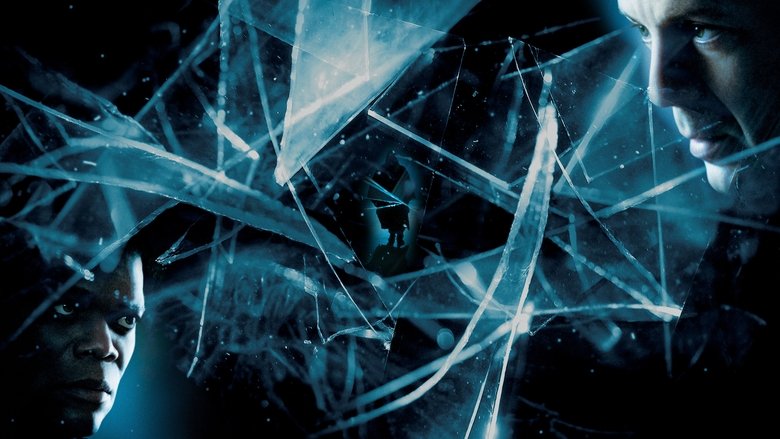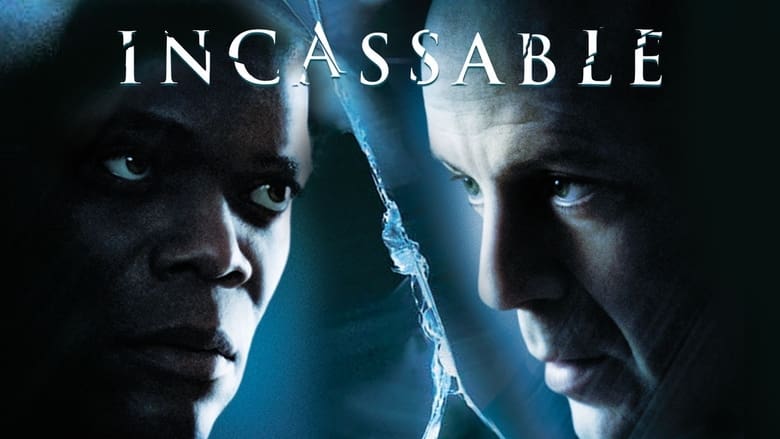Quelle: themoviedb.org
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org

- Start 28.12.2000
- 107 Min MysterySci-FiDramaThriller USA
- Regie M. Night Shyamalan
- Drehbuch M. Night Shyamalan
- Cast Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard, Eamonn Walker, Leslie Stefanson, Johnny Hiram Jamison, Michaelia Carroll, Bostin Christopher, Elizabeth Lawrence, Davis Duffield, Laura Regan, Chance Kelly, Michael Kelly, Firdous Bamji
Kritik
Fazit
Kritik: Jacko Kunze
Beliebteste Kritiken
-

Kritik von lori007101
Eigentlich hat es Shyamalan mit seinem Film „Unbreakable“ gut gemeint, doch das Ergebnis ging nach hinten los! Man merkt hier schon, dass Shyamalan an seinem vorderen Erfolg „The Sixth Sense“ unter Druck stand. Denn er versuchte hier, das gleiche Rezept anzuwenden, wie bei seinem Vorgängerfilm. Was dabei herauskam ist leider...
Moviebreak empfiehlt
Wird geladen...
×