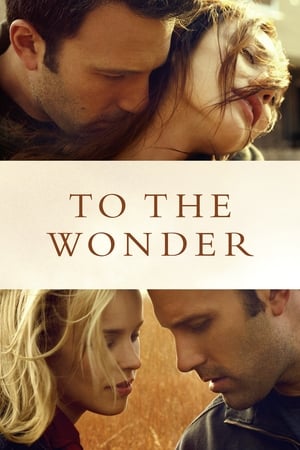Es ist wie ein orchestrales Stück der alten Großmeister: ein einzelner Ton der Ouvertüre verstärkt sich, wird untermalt, unterstützt, vollzieht in diversen Akten verschiedene Wandlungen und findet eine gewitterartige Entladung im Finale, ehe die Ruhe wieder einkehrt. Terrence Malick ist so ein Komponist. Und Philosoph. Wenn er dies in seinen Filmen vermischt, erscheint jedes Mal ein ganz besonderes, für sich stehendes Werk. Es sind die Aufmachung und die Themen, die sich wiederholen: die Liebe zum Menschen und die Widmung seiner Probleme – oftmals im Sinnbild der Natur. Es entstehen philanthropische Oden, die alles sind, aber niemals ein Abgesang auf den Menschen. Im neuesten Stück „To the Wonder“ inszeniert Malick die Liebe per se und die damit verbundenen Hoffnungen und stürmischen Gewalten.
Mit dem schmetterlingshaften Bauchkribbeln setzt der Ton der Liebe ein und zeigt uns die ersten Momente der noch jungen Liebe zwischen Marina (Olga Kurylenko) und Neil (Ben Affleck), die sich in Frankreich kennenlernen. Die Beziehung nimmt an Fahrt auf und Marina beschließt, auf Neils Angebot, mit ihm zurück in die Vereinigten Staaten zu gehen, einzugehen. Doch in der Trostlosigkeit Oklahomas findet Marina keine Ruhe. In ihrem Unglück wendet sie sich an den Pater Quintana (Javier Bardem), der jedoch in seinem eigenen Glaubenskonflikt steht. Es beginnt zu brodeln in der Komposition „To the Wonder“ und erwartet in jedem Moment eine Entladung, sowohl in der Liebe zwischen Marina und Neil, als auch in der Gottesfrage von Pater Quintana, die sich dann in unterschiedliche Richtungen entwickelt.
Nach seinem Cannes-Erfolg mit „The Tree of Life“ erscheint „To the Wonder“ untypisch. Nicht nur hat sich Terrence Malick weniger als zwei Jahre für das Projekt Zeit genommen, wogegen er dafür bekannt ist, meist sechs-sieben Jahre verstreichen zu lassen, sondern gelangt der Film auch weniger offensiv in die Kinos. Nur durch Plakate und wenige Trailer macht Malick auf seinen Film aufmerksam, während bei „The Tree of Life“ der Hype schon vor dem offiziellen Start kaum zu bremsen war. Doch passt genau dieses Konzept eher zum Regisseur, der sich oft wortkarg und pressescheu gibt. Ähnlich ist nun auch „To the Wonder: ruhig und verhalten lässt Malick seine Arie der Liebe immer weiter ansteigen und fügt ihr doch den Hauch von Spannung hinzu, welche sich im für den Zuschauer Ungewissen entladen soll.
Man muss Malick mögen, um seinen Filmen einen Wert abgewinnen zu können. Sein Beitrag zum Kriegsfilmgenre etwa, „The Thin Red Line“, zieht seine Stärke nicht aus kriegerischen Gewaltszenen, sondern aus dem Voice-over der handelnden Figuren, die darin in philosophisch-anmutenden Phrasen ihre Gedanken formulieren. So besteht auch „To the Wonder“ aus vielen, langen Einstellungen, in denen nicht viel passiert und nicht viel gesagt wird, aber dennoch so viel gezeigt wird. Reden tun die Protagonisten kaum. Ben Afflecks Dialogsätze lassen sich an der Hand abzählen. Lediglich die – wieder in Off-Kommentaren gepackten – Gedanken von Kurylenko und Bardem bestimmen das Handlungsgeschehen.
Dazu kommen die Traumsequenzen-ähnelnden Spaziergänge: Die Figuren streifen durch das Gras, durch das Getreide, meist im Abstand zueinander und tanzen apathisch umher, während die Kamera knapp über der Handlungsebene filmt und so die Figuren selten fokussiert, sondern sich eher ihren Händen widmet. Das kann für den Zuschauer, der Malick nicht kennt, sehr schnell zur Langatmigkeit und Tour de Force ausarten, denn die Gedankenarbeit muss er selbst verrichten. Für Malick-erprobte Zuschauer ist dies nichts Neues, verursacht aber so manches Augenverdrehen, wenn in kurzen Abständen auf das Neue umher gewandelt wird. Unterlegt mit Klängen der alten Meister, wie Wagner, Berlioz und Tchaikovsky mutet das eher einer psychologischen Wallfahrt an, statt einem Kinofilm.
Doch das Ziel ist nicht das Ende der Reise – es ist in Form der Liebe allgegenwärtig. Malick widmet der omnipotenten Liebe der Menschen untereinander einen Film. Er ist dabei nicht verherrlichend, denn dazu gibt es auch Streit, Misserfolg oder gar das Auseinanderbrechen von Beziehungen. Der Regisseur inszeniert den Realismus der Leidenschaft und setzt ihr, wie das Leben, manchmal ein jähes Ende. In diesem Reigen können die Protagonisten nur schwer überzeugen. Wenn es jemand tut, dann ist es die jugendwilde Ausstrahlung von Olga Kurylenko oder die stoisch, doch zweifelnde Rolle von Javier Bardem. Gerade wenn das Orchesterstück ihren Höhepunkt erreicht, ist es Bardem, der die Figuren und somit den Zuschauer an das erinnert, was einzig wichtig ist. Er stellt die Bedürfnisse Anderer über seine eigenen und verkörpert damit die Philanthropie an sich – ein mögliches Spiegelbild zum Regisseur Terrence Malick.
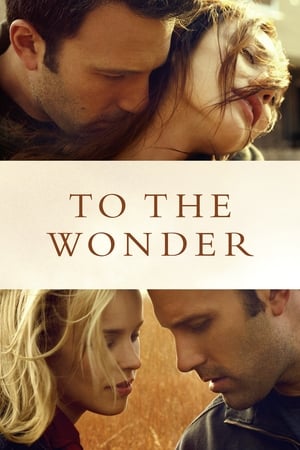 Trailer
Trailer