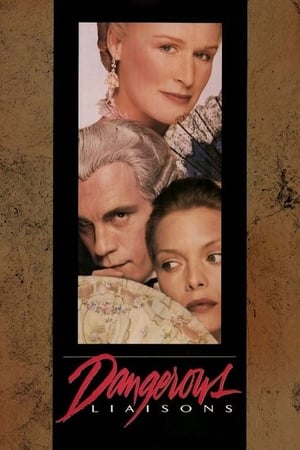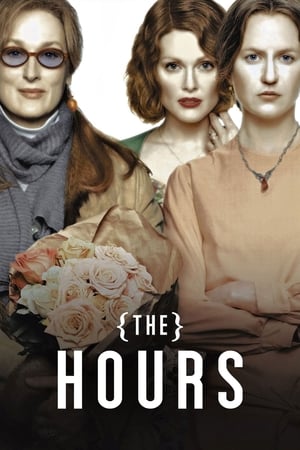Wie viel Schmerz, Scham und Groll sich über all die Jahre im Inneren von Joan (Glenn Close, Eine verhängnisvolle Affäre) angeballt haben, wird vorerst vor allem messerscharf durch ihre Augen artikuliert: Ein frostiger Blitz schießt immer wieder aus ihrem Blick, hervorgeholt aus den tiefen einer mit Verletzungen nur allzu vertrauten Seele. Der schwedische Regisseur Björn Runge (Happy End) spürt der Provenienz dieser Verletzung in der Adaption des Romans Die Ehefrau von Meg Wolitzer nach und entdeckt dabei viele interessante Ansätze, aber leider wenig komplexe Grundierung. Vor allem ist Die Frau des Nobelpreisträgers ein erneuter Nachweis dahingehend, wie formidabel die große Glenn Close doch ist – und wie sie nicht nur allein durch ihre Präsenz einen Film an sich reißen kann, sondern über weite Strecken auch retten.
In den Morgenstunden klingelt das Telefon, es ist die Nobelstiftung, die Joe (Jonathan Pryce, The New World) mit dem Literatur-Nobelpreis honorieren möchte. Die erste Reaktion von Joan und Joe? Sie hüpfen, übermannt von kindlicher Freude, gemeinsam auf dem Bett herum. Das Ehepaar hat in all den Jahren des Zusammenseins Höhen und Tiefen erfahren und gemeinsam geleistet, der Nobelpreis ist nun auch eine Auszeichnung für das (augenscheinlich) erfolgreiche Nehmen der Hürden, die die Zeit einer Ehe zwangsläufig aufwirbelt. Dass Joe in Wahrheit nicht das literarische Genie der Familie ist, wird schnell deutlich, allein durch die bereits eingangs erwähnten Blicke von Glenn Close, die von einem Leben der Selbstverleugnung sprechen. Runge und seine Drehbuchautorin Jane Anderson aber müssen diesen Umstand bis in den letzten Winkel ausformulieren.
Dieser plakative Zwang, das Offensichtliche zu verbalisieren, stellt das wohl größte Problem von Die Frau des Nobelpreisträgers dar, weil sich der Film viel zu oft mit wenig eleganten Erklärungen zufrieden gibt, anstatt dem Zuschauer den Raum zu lassen, seine eigenen Schlüsse aus den Gegebenheiten zu ziehen, die ihm das pointierte Spiel der Schauspieler darbieten. Mag Jonathan Price der – wie gewohnt – zur Hochform auflaufenden Glenn Close auch gnadenlos unterlegen sein, in seiner Egomanie, seiner Geltungssucht, seinem Drängeln dahingehend, unbedingt berücksichtigt und dekoriert zu werden, steckt viel männliche Fragilität, die ihre Wurzeln in der Vergangenheit schlägt. In Form von mal mehr, mal weniger sinnstiftenden Rückblenden wird nicht nur der Betrug an sich und der Welt deutlich, sondern auch ein auf den Kopf gestelltes Geschlechterverhältnis.
Während Joan acht Stunden hinter der Schreibmaschine verbringt, um den nächsten Meilenstein zu verfassen, hat Joe sich um den Haushalt und die Kindererziehung gekümmert. Strukturierte sich der Roman noch als umfangreiche Parallelmontage, die über die Erläuterung verschiedener Zeitebenen ausgefeilte Charakterprofile erschuf, so wirken die Sequenzen hier, die Joe und Joan in jüngeren Jahren präsentieren, gerne wie die Auswüchse eines faulen Storytellings, weil sie die Persönlichkeiten der Protagonisten nicht intensivieren, sondern mit einfachen, schnell abgefrühstückten Antworten verkürzen. Man möchte sich nicht vorstellen, wie Die Frau des Nobelpreisträgers ausgesehen hätte, könnte der Film sich nicht auf die facettenreiche, inbrünstige und gleichzeitig subtile Performance von Glenn Close verlassen. Sie verleiht dem Szenario trotz reichlich ungenutztem Potenzial Intimität, Kraft und Kontur. Sie macht den Film dort lebendig, wo er eigentlich in Konventionen erstarren würde.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org