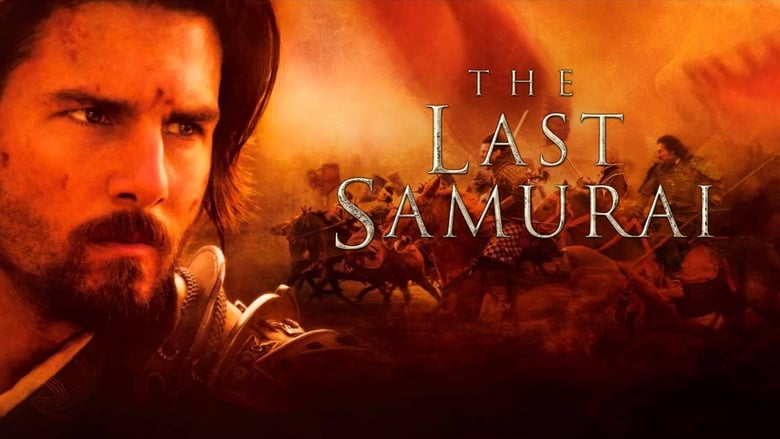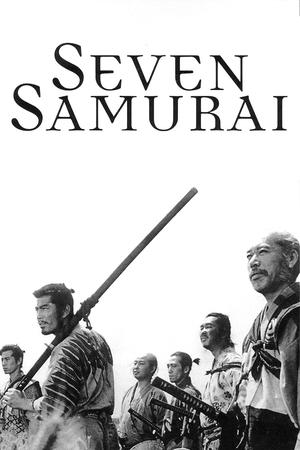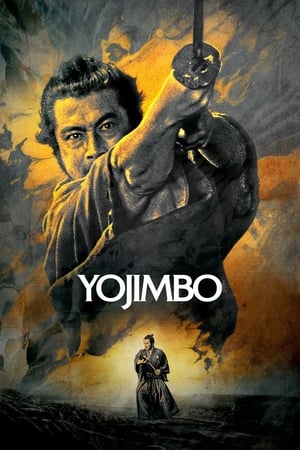Samurai-Filme sind mittlerweile zwar mehr oder weniger eine Seltenheit, doch hat dieses Subgenre seine Wurzeln schon als Stummfilm in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Nach der relativen Bedeutungslosigkeit in den zwei darauf folgenden Jahrzehnten, war es Akira Kurosawa und Hiroshi Inagaki (später auch Masaki Kobayashi), die die disziplinierten Schwertkämpfer wieder vermehrt auf die Leinwand brachten. „Die Sieben Samurai“ (1954), „Yojimbo“ (1961), die „Samurai“-Trilogie (1954-56) und „Zatoichi“ (1962; von dem 26 Nachfolger gedreht wurden) gelten als absolute Meilensteine der Filmgeschichte, die mit ihrer zynischen, brutalen Art, ihrer Gewalt (samt Blutfontänen) die Samurai-Filme und ihre Kämpfe viel realistischer darstellten („Kill Bill“ lässt grüßen). Von diesem Realismus ließ sich einige Jahre später Sergio Leone inspirieren, als er den Film „Für eine Handvoll Dollar“ (ein inhaltliches Remake von „Yojimbo“ im Western-Setting) drehte und nebenbei den alten Western zum Italo-Western umrevolutionierte. 2003 gewährte Regisseur Edward Zwick (Blood Diamond, Shakespeare in Love) Einblick in den Alltag eines Samurai, indem er Tom Cruise als Kriegsgefangener in ein Samurai-Dorf während der Meiji-Restauration schickte.
Die Geschichte des Mannes, der in dem feindlichen Lager zu leben lernt, die Gewohnheiten und Kultur des Feindes lieben lernt und im ursprünglichen Feind eine neue Familie findet, kennt man schon in gewisser Weise aus den Disney-Filmen „Pocahontas“ und „Tarzan“, aus dem Film mit den blauen Riesen „Avatar“, aus „Der mit dem Wolf tanzt“ und einer Reihe von weiteren Streifen, die sich allesamt dieser Thematik widmeten. Und dieses „Schon-mal-gesehen“-Gefühl versprüht der Film zwar die ganze Zeit über, ist aber spätestens dann vergessen, wenn man erkennt, worum es Regisseur Edward Zwick wirklich geht.Nämlich um die Samurai selbst. Werte wie Disziplin und Respekt, Ehre und Liebe werden in diesem kleinen Paralleluniversum größer geschrieben, als alles andere, in das Algren hinein gerutscht ist. Während auf dem Schlachtfeld die Samurai sich fast schon stilsicher metzelnd und hackend durch die Gegnermassen mähen, ist der Kontrast umso stärker, der mit der Einführung in den Alltag eines Samurai eintritt. In diesem herrscht so viel Ruhe und Frieden, wie scheinbar an sonst fast keinem Ort auf der Welt, wobei die fantastischen Bilder allein den Film rechtfertigen (gedreht in Neuseeland von „Braveheart“-Kameramann John Toll). Die Samurai trainieren und meditieren, zeigen höchste Disziplin, vergessen aber auch nicht die Freude am Leben. Spiel und Spaß gehört ebenso dazu, wie die Arbeit.
Die Frauen kennen ihren Platz auf der Welt, sind stets höflich, sind für das Reinigen, das Kochen und die Kinder zuständig. Jeder hat eine Rolle in diesem nahezu minimalistischen Mikrokosmos. Tradition und Kultur werden dabei nicht vergessen. Der Zuschauer identifiziert sich selbstverständlich am besten mit Tom Cruise, da er selber als Unwissender dem Publikum am Nächsten steht. Mit ihm zusammen den Alltag in einem kleinen Dorf zu studieren, die Sitten und Bräuche kennen zu lernen, macht einfach enormen Spaß.Apropos Tom Cruise: Schauspielerisch ist er nicht allein das Highlight des Films, diese Ehre teilt er sich mit Ken Watanabe (Letters From Iwo Jima, Inception). Tom Cruise (Krieg der Welten, Rain Man) ist aber definitiv von einer Katastrophe à la „Mission Impossible II“ weit entfernt. Den Wandel vom Alkoholiker, über den unwissenden und unpassenden Fremden, bis zum seelisch reinen Mann, der endlich seinen Frieden gefunden hat, bringt er sogar richtig gut und überzeugend rüber. Auch die Tatsache, dass er für die Szenen mit dem Schwert ein 8-monatiges Trainingsprogramm im Kendo absolviert hat, gebührt ihm Respekt, generell macht er so auch in den Kampfszenen eine sehr gute Figur.
Ken Watanabe (nominiert für den Oscar) hingegen überzeugt als moralischer, wissensbegieriger und sich seiner Pflichten bewusster Anführer, der überhaupt die Freundschaft zwischen seiner Figur des Katsumoto und Algren ermöglicht . Durch Ken Watanabe verkommt „Last Samurai“ nicht zur One-Man-Show von Tom Cruise.Wie bereits erwähnt, können die Bilder von John Toll des japanischen Dorfes, der Architektur und der wunderschönen Natur vollends überzeugen. Gerade im Zusammenspiel mit dem teils ruhigen, teils epochalen Soundtrack von Hans Zimmer, haben sie fast schon eine magische Anziehung. Gerade das große Finale ist nahezu perfekt inszeniert, doch ist es ein wenig zu melodramatisch (um nicht zu sagen kitschig).Das wäre auch einer von zwei Patzern, die sich der Film erlaubt: Er ist teilweise wirklich sehr kitschig und vorhersehbar, sodass das Ende schon sichtbar ist, bevor man es sieht. Doch gehört „Last Samurai“ zu jenen Filmen, die eine Geschichte erzählen, die man so schon eine Millionen Mal gehört, gesehen und gelesen hat, doch funktionieren sie, bei fachmännischer Ausführung immer wieder und sorgen jedes Mal für Gänsehaut. Der zweite Punkt wäre die doch sehr starke historische Ungenauigkeit. Dieser Aspekt fällt allerdings erst dann auf, wenn das Publikum sich mit der Kultur der Samurai auskennt und ist somit nicht wirklich als „schlecht“ zu titulieren.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org