„Not besiegt den Stolz.“
Es gibt unzählige Filme, die nicht einmal zwangsläufig der Ursuppe der Kinematographie entwachsen sind und dennoch zum Pflichtprogramm eines jeden Filmliebhabers gehören, da diese ein grundlegendes Verständnis dahingehend liefern, wozu Kino in der Lage sein kann. Citizen Kane ist so ein Beispiel, Vertigo – aus dem Reich der Toten ebenso, genau wie I Am Cuba, Persona und nicht zuletzt Die sieben Samurai von Akira Kurosawa (Rashomon – Das Lustwäldchen). Gerade die Entdeckung des bis über 200 Minuten andauernden Die sieben Samurai müsste für die Zuschauerschaft von heute von nicht geringerem Interesse sein, hat Kurosawa hier doch bereits in Sachen Struktur, Bildsprache und Dramaturgie alles begründet, worauf das moderne Blockbusterkino basiert. Kein Wunder, dass der japanische Klassiker zu den meistzitierten Filmen überhaupt zählt.
Angesiedelt im feudalen Japan des 16. Jahrhundert, zeichnet Akira Kurosawa sein Heimatland unter den Parametern einer verbürgten Historizität nach: Japan war seiner Zeit ein Land, welches sich durch die stetig wechselnden Herrscher zusehends zerklüftete. Bürgerkriege standen an der Tagesordnung, Bauern bestritten einen täglichen Überlebenskampf, weil raubende Banden ihnen die gesamte Ernte abnahmen und die Samurai, ehrenhafte Schwertkämpfer, die ihr Dasein nach einem strengen Moralkodex, dem Weg des Kriegers, ausgerichtet haben, zeigen sich als herrenlose Überbleibsel einer Zeitrechnung, die immer stärker verblasst. In dieses düstere Stimmungsbild entlässt uns Kurosawa mit Die sieben Samurai – und er erzählt genau diese Geschichte. Von Bauern, die nicht nur überleben, sondern leben wollen. Von Samurai, die ihren Platz in einer Welt suchen, in der sie eigentlich keinen Platz mehr haben.
In nach wie vor hochgradig beeindruckend komponierten Klang- und Bildwelten, versteht es Akira Kurosawa, sein unverwüstliche Epos aus der Tiefe des filmischen Raumes zu erschließen. Keine Einstellung dieses Films ist eindimensional, kein Kameraschwenk ein leeres Versprechen, kein Schnitt Augenwischerei. Wenn es ein Filmemacher jemals vollbracht hat, die Weite eines (audio-)visuellen Tableaus bis in den letzten Winkel mit gestalterischer Wucht auszukleiden, dann wohl Akira Kurosawa (Lawrence von Arabien-Regisseur David Lean sollte die japanische Lichtgestalt alsbald beerben). Allein der Umstand, wie es ihm gelingt, Eindrücke der Natur und Witterung, die Blumenwiesen, die Getreideähren, der sich verdichtende Wald, der prasselnde Regen, als allegorische Seelenlandschaft zu benutzen, um nicht nur den Gemütszustand einzelner Charaktere zu beschreiben, sondern simultan dazu auch ihre Verbindung zur Natur höchstselbst, imponiert durch feingliedriges bildliches Erzählen.
Sobald es die Bauern vollbracht haben, eine siebenköpfige Gruppe an Samurai zu mobilisieren, die sich von nun an darum kümmert, das Dorf vor den Marodeuren zu beschützen, schält sich aus dem Inneren der Narration eine immer prägnantere Auseinandersetzung mit dem Wert der Zivilcourage an die Oberfläche. Die sieben Samurai beschreibt eine Welt, in der jeder für sich kämpft oder Gründe dafür vergessen wurden, warum man überhaupt in den Kampf ziehen sollte. Das mitmenschliche Handeln, welches hier von den Samurai ausgeht, gleicht einer zwischenmenschlichen Utopie, eben weil sie für eine gerechte Sache die Schwerte erheben, die sie letztlich nichts angeht. Sie handeln uneigennützig, appellieren durch ihr Agieren an den gesunden Menschenverstand, an das Gemeinschaftsgefühl, an Solidarität und hebeln somit den engmaschigen Gedankenhorizont innerhalb der zeitgenössischen Kastengesellschaft Japans aus.
Nicht das Auseinanderdividieren der jeweiligen sozialen Stellungen erklärt eine gesunde Gesellschaft. Es ist das Aufheben jener Grenzen und das Zusammenwirken von Menschen, die in verschiedenen Realitäten existieren, in der vorurteilsfreien Kollektivierung aber beweisen, dass das gesellschaftliche System intakt ist. Das mutet nun, wie gesagt, ungemein utopisch und romantisch an, trifft die Tonalität von Die sieben Samurai aber auch „nur“ im gedanklichen Kern. Kurosawa glaubt an den Menschen, glaubt an das Bündnis, glaubt an das gegenseitige Vertrauen. Dass Die sieben Samurai dennoch ein bedrückendes Werk bleibt, liegt vor allem daran, dass Kurosawa in eindringlicher Klarheit aufzeigt, dass Menschen nicht immer zu retten sind, auch wenn man sich für sie einsetzt. Die Samurai scheinen Relikte, unzeitgemäß, anachronistisch. Wenn sie in die Zukunft blicken, sehen sie die Gräber ihresgleichen. Immerhin aber war der letzte Kampf von Bedeutung.
Und Kurosawa setzt mit diesem Entscheidungsgefecht (oder allgemein mit den Kampfsequenzen) Maßstäbe. Mit dem Einsatz mehrerer Kameras, die ein ausgeklügeltes Spiel verschiedener Perspektiven erlauben und somit eine unvermittelte Dynamik erschaffen, war Kurosawa seiner Zeit weit voraus. Ohnehin ist Die sieben Samurai in erster Linie als visionäres Meisterwerk zu verstehen: Der Film hat die Struktur der kontemporären Actionfilms vorweggenommen, während er sich simultan dazu als ausdrucksstarke Gesellschaftskritik verdient gemacht hat und sich im nächsten Schritt auf wertschätzende, aber niemals verherrlichende Weise mit dem Kriegerstand der Samurai beschäftigt. Am Ende gibt Kurosawa zu verstehen, dass der Moralkodex der Samurai nicht von überzeitlicher Beschaffenheit ist. Vielleicht sollte man die Chance nutzen, noch einmal für etwas Bedeutsames einzutreten, denn bald schon muss man die Mythen Mythen sein lassen.
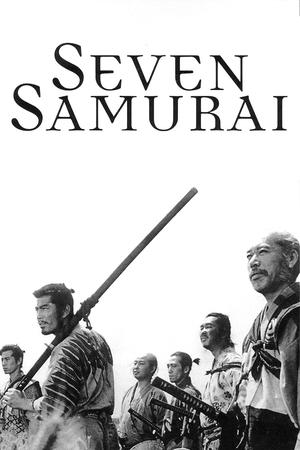 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org
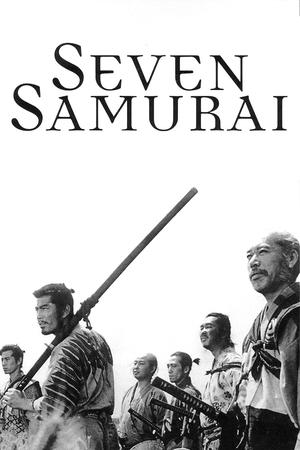






















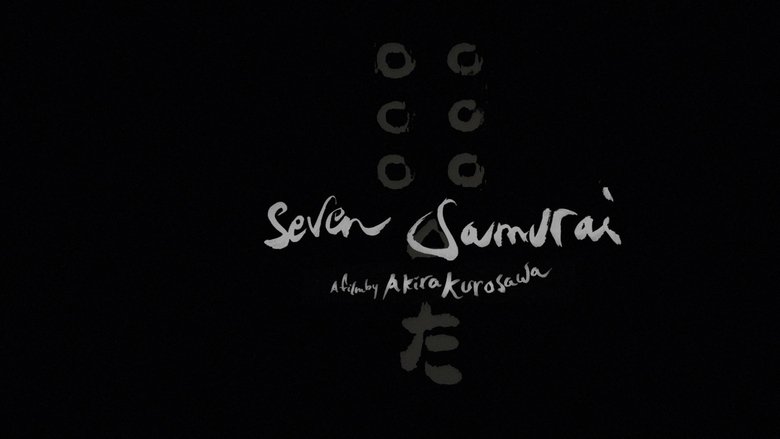









Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!