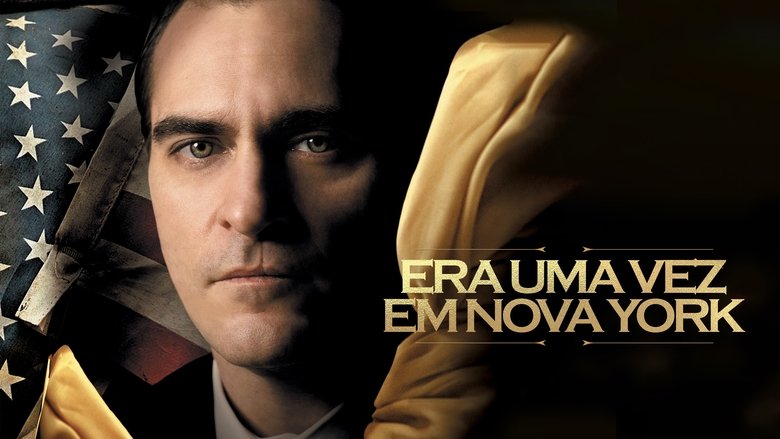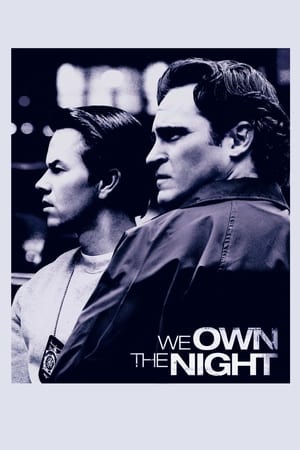Nie wirklich auffällig und doch immer anwesend: So ließe sich wohl die Karriere des hochinteressanten James Gray, der sicher kein Duckmäusertum präferiert, aber den großen Rummel um seine Person kategorisch ablehnt und seit jeher gekonnt laviert, kurz und knapp beschreiben. Das Fazit seines bisherigen Outputs aber kann sich ohnehin sehen lassen, denn jedes seiner Werke ist dann letzten Endes doch irgendwie sehenswert geglückt. Vor allem seine bitterkalte Milieu-Studie „Little Odessa“, mit dem Gray 1994 debütierte, sowie die unaufgeregte Liebestragödie „Two Lovers“ um eine unerfüllte Dreiecksbeziehung in Brooklyn blieben im Gedächtnis haften, zeigte sich Gray doch als ein kompetent antizipierender Filmemacher, der seine formale Strenge niemals mit Kollateralschäden auf inhaltlicher Ebene austrug. Seinen neusten Film, „The Immigrant“, könnte man nun in Bezug auf sein Schaffen sowie den umfassenden Zuschnitt als das wohl eisernste Projekt bezeichnen, welches Gray jemals unter seine ausstaffierte Ägide nahm.
Im Schatten melodramatischer Klassiker der goldenen Ära gebiert, ist „The Immigrant“ ein Film geworden, der den modernen Usus unter dem inhärenten „Höher, Schneller, Weiter“-Emblem mit nachdrücklicher Vehemenz entsagt: „The Immigrant“ ist derart entschleunigt dargeboten, dass einen spätestens nach einer Stunde das Gefühl erschleicht, der Film hätte den Rückwärtsgang eingeschlagen und würde nun Schritt für Schritt zurück setzen. Dass diese Besonnenheit, diese Geruhsamkeit, aber gänzlich zum Kunstverständnis des James Gray gehört, der nie ein Mann für breitbeinige Posen oder eine sich überschlagende Taktung war, weiß man, wenn man sich schon etwas mit seiner Person als Filmschaffender auseinandergesetzt hat: James Gray steht nicht für die Eskalation und den großen Knall ein, es das heimliche Vibrieren und Zittern unter der Oberfläche, welches langsam vom Sub- in den Primärtext transferiert wird und all die emotionalen Zwickmühlen sukzessive an das Tageslicht befördert. Im Kosmos James Gray, einem Kosmos, der dem Realismus in der fiktionalisierten Reminiszenz auf den Zahn fühlt, trägt jeder sein Kreuz.
Im New York 1921 verlagert, bekommen wir polnische Einwanderin Ewa Cybulski (Marion Cotillard) vorgestellt, die zusammen mit ihrer Schwester in den USA Fuß fassen möchte. Als sie von ihrer Schwester getrennt wird und in die Hände von Bruno Weiss (Joaquin Phoenix) gerät, der in seinem Etablissement auf Ellis Island immer tüchtige Arbeiter gebrauchen kann. In dieser Einrichtung ist auch Brunos Cousin Orlando (Jeremy Renner) bedienstet, einem Illusionisten alter Schule, der sein Geld damit verdient, Leute an der Nase herumzuführen – Einer Tätigkeit, der auch Bruno nachgeht, allerdings nicht auf der Bühne. Unter diesen Umständen bereitet James Gray ein Motiv auf, welches „Two Lovers“ ebenfalls bediente: Die affektiven Spannungen innerhalb eines Dreiergespanns. Bruno weiß, dass Ewa verzweifelt ist: Europa ist gezeichnet vom Krieg und ihre Hoffnungen auf ein besseres Leben könnten angesichts des von der Depression zerfressenen Amerikas ebenfalls in Sekundenschnelle schwinden. Umgarnen steht nun für ihn auf der Agenda, falsche Versprechungen und die Impertinenz, Ewa in die Prostitution zu entlassen.
Inmitten der komprimierten Farbpalette, die „The Immigrant“ tatsächlich wie einen Film aus längst vergangenen Tagen wirken lässt, wo der Hintergrund des Bildes in schalen Gelbtönen verschwimmt und nur das durchschlagende Licht der Taschenlampen den farblich arretierten Raum in spitzen Kegeln durchbricht, um bis zum Zuschauer vorzudringen, wird Ewa in ein unstetes Amerika geworfen, welches sich nicht entscheiden kann, ob es sich die Schuld und den Schmerz seiner Einwanderer aufbürden soll oder ob es sich doch bereit zeigt, Zuversicht zu spenden. Orlando entgegnet der zwischenzeitig zur 2-Dollar-Hure verdammten Ewa mit positiver Note, bewahrt sich ein ehrliches Lächeln, muss aber später noch dafür büßen, ist sich Bruno doch nicht im Klaren darüber gewesen, in welche Situation ihn die Ausmaße seiner Zuneigung zu Ewa noch manövrieren werden: Wie Joaquin Phoenix diese – im Endeffekt – Überrumpelung schierer Menschlichkeit ausspielt, gehört erneut zur höchsten Klasse einnehmender Performancekunst. Die fragil agierende Marion Cotillard hingegen wird oftmals durch die ausgeklügelte Lichtdramaturgie charakterisiert, Licht und Schatten bergen einfach ein ungemeines metaphorisches Potenzial - Und Gray nutzt es.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org