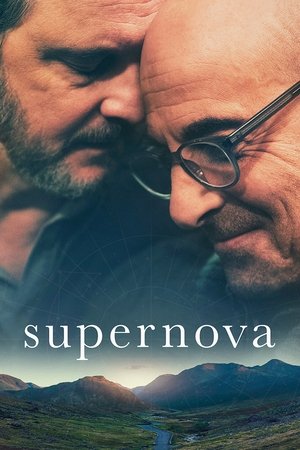Es steht außer Frage, dass bei Supernova ein sehr sensibles Thema behandelt wird. Normalerweise lösen Filme über eine ähnliche Thematik sogar bei völlig unbeteiligten Zuschauern zumindest ein Minimum an Gefühlen aus. Man entwickelt im Normalfall Empathie sowohl für die Betroffenen selbst, als auch für ihre Angehörigen. Es wäre verwunderlich, wenn man mit Supernova nicht die gleichen Ziele verfolgt hätte. Vorliegend ist jedoch fraglich, ob man mit diesem Film tatsächlich die Intentionen erreichen kann, die man beim Drehen im Hinterkopf hatte. Schon das Drehbuch an sich ist problematisch, weil es so gut wie gar nicht zeigt, welche Auswirkungen die Demenz im gegenwärtigen Stadium auf Tusker (Stanley Tucci, The Silence) hat. Das deutlichste Anzeichen ist, dass er während der Reise kurz verschwindet, weil er ein wenig verwirrt ist. Sonst ist er völlig klar bei Verstand und kommuniziert, wie jeder andere Mensch auch, sodass man sich ständig fragt: „Fehlt ihm denn überhaupt irgendwas?“
Bei diesem Film wird einfach zu sehr vorausgesetzt, dass man sich mit Demenz und allen Stadien der Krankheit gut auskennt und sofort weiß, was Tusker als Nächstes droht. Wenn man allerdings gar nichts über die Erkrankung weiß, dann wirkt es befremdlich, dass der Mensch, der völlig gesund wirkt und nur ein paar kleine Aussetzer hat, sofort aufgibt, obwohl im Grunde genommen der schlimmste Fall noch gar nicht eingetreten ist. Die ganze Reise wirkt derart melancholisch und schwermütig, dass man überhaupt keine Freude verspürt, während die Protagonisten durch schöne Landschaften fahren. Vermutlich soll man auch keine Freude verspüren und der ganze Film zielt nur darauf, den Zuschauer um jeden Preis zum Weinen zu bringen. Doch das gelingt einfach nicht. Es ist tatsächlich schwer für eine Figur Mitgefühl zu entwickeln, die vor Selbstmitleid nur so zerfließt und ständig darauf herumreitet, dass irgendwann mal in der nächsten Zukunft irgendetwas passieren wird, wobei nicht einmal klar ist, wann es so weit sein wird. Mit dieser Lebenseinstellung könnte man eventuell auch Angst davor haben, von einem Blitz erschlagen zu werden. Es liegt zumindest im Bereich des Möglichen.
Auch wenn Tusker die schlimme Diagnose erhalten hat, ist es trotzdem kein Grund so pessimistisch zu sein. Statt in schönen Erinnerungen zu schwelgen und das Leben so lange auszukosten wie es geht, ist Tusker nur am Jammern und das mit einer derart heroischen Haltung, als hätte er gerade ein paar Kätzchen aus dem Feuer gerettet, wobei der Schauspieler selbst natürlich einen exzellenten Job macht. Er spielt jemanden, der seine Erkrankung, als schwere Bürde empfindet und stolz darauf ist, mit was für einer Fassung er das alles erträgt. Das Drehbuch gab leider nicht mehr her und der ganze Film ist ungefähr so lebensbejahend wie das Aussuchen eines Sarges während man noch in der Blüte seines Lebens steht. Man hätte den Figuren ruhig ein bisschen Hoffnung oder den Silberstreifen am Horizont zugestehen können, dann wäre man als Zuschauer eher geneigt etwas zu fühlen. Ein Spannungsaufbau hätte dem Film auch nicht geschadet.
Supernova richtet sich eher an diejenigen, die intensive ermüdende Gespräche über Krankheiten mögen und nicht viele Szenen brauchen, die den beginnenden geistigen Verfall skizzieren. Es ist einfach schade, wie viel Potenzial für einen guten Film hier verschenkt wurde. Trotzdem sind die Darbietungen der beiden Hauptdarsteller das Highlight des Films. Beide haben ihren eigenen Zugang zu der Demenz-Thematik gefunden. Sie spielen liebevolle Partner, die die Liebe zueinander auf ihre besondere Art ausdrücken. Sam (Colin Firth, Mamma Mia!) ist der aufopferungsvolle starke Partner, der an seine Grenzen stößt und trotzdem bereit ist noch viel mehr zu tragen, als er jetzt schon auf seinen Schultern tragen muss. Tusker dagegen möchte niemandem zu Last fallen und trifft schon Vorkehrungen für seine spätere hilflose Zukunft. Beide Schauspieler machen wirklich einen guten Job und können absolut gar nichts für das pessimistische, unausgereifte Drehbuch.
Das Leben gehört den Lebenden, darum ist es schade, dass der Film nicht ein paar lebensbejahende Aufnahmen enthält und leider eine Hauptfigur hat, die sich am liebsten lebendig begraben würde. Sogar die Musik während des Roadtrips hört sich eher an, wie ein Trauermarsch. Dabei wäre es ein leichtes gewesen ein paar Szenen einzustreuen, die einen Menschen darstellen, der das Leben genießt, auch wenn nur für ein paar Stunden. Um so größer wäre der Kontrast zu späteren Traurigkeit und umso mehr könnte man die Beweggründe der Figur nachvollziehen. Bedauerlicherweise verschwendet die Hauptfigur die wertvolle Lebenszeit, die sie eigentlich erst Recht auskosten müsste, solange es noch geht.
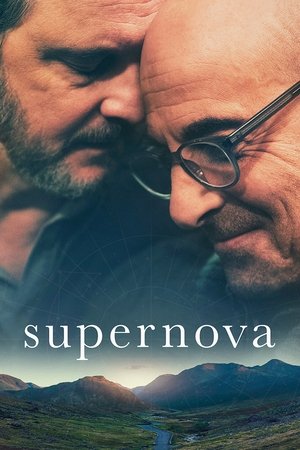 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org