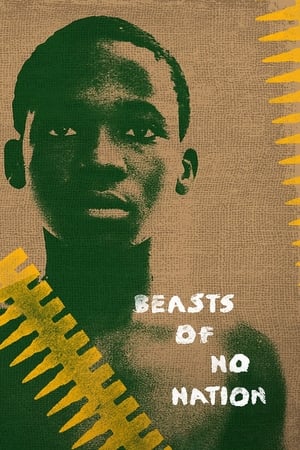Kritik
Der US-amerikanische Bezahlsender HBO ist hauptsächlich dafür bekannt, den Standard an langen Serien-Formaten immer weiter in die Höhe zu bringen. Dabei sind Serien mitnichten die einzigen Formate, die der Sender produziert. Zahlreiche Sport-Events überträgt HBO außerdem, immer wieder kommen erfolgreiche, tiefgreifende und mutige Dokumentationen nach Übersee (man denke einmal an „Going Clear: Scientology and the Prison of Belief“, für den HBO ein Heer von Anwälten anstellte, um sich gegen jegliche Beschuldigung von Scientology wehren zu können (es kamen keine)) und immer wieder werden kleinere TV-Filme produziert. „Nachtigall“ ist einer dieser Filme, der zeitlich für ein 90-Minuten-Fenster im Ausstrahlungstermin komprimiert wurde und zudem eine durchaus relevante Thematik behandelt; die psychische Störung eines jungen Ex-Soldaten.
„There is no Escaping Your Own Mind“ behauptet der Untertitel des Films - seinem Verstand kann man nicht entkommen. Das ist wohl so und im Normalfall sollte das auch gut so sein, eine Eigenschaft, die den Menschen zu dem macht, was er ist. Dann allerdings gibt es Situationen und Personen, bei denen diese Eigenschaft zum Verhängnis wird. Paranoia, Hyperventilierung, pseudo-somatische Krankheiten, Phantomschmerz, Depression, die Liste scheint unendlich. Nicht eine Liste der Abnormitäten, viel mehr eine Liste der Last. Mit den Folgestörungen der Psyche eines ehemaligen Soldaten schneidet der Film bestimmt auch heute noch in das Fleisch vieler Amerikaner. Dabei ist eine kritische Betrachtung des Krieges, der Armee und der amerikanischen Heldenverklärung von Soldaten nichts neues. Während letzteres wohl seit Anbeginn der Zeiten in Mode ist (man kann nicht ehrenvoller sterben als im Kampf „für sein Land“), kamen die anderen Vorgänge vor allem mit dem Vietnamkrieg in den Umlauf. Ein Krieg, der sozusagen „live“ im Fernsehen zu betrachten war und damit einen immensen Einfluss auf die kulturelle Eigenschaft eines ganzen Landes nahm. Stichwort „New Hollywood“, Stichwort Abschied von der Goldenen Ära der Traumfabrik.
Revolutionär oder visionär neuartig ist „Nachtigall“ also nicht und tatsächlich scheinen sich jegliche Kritiken zum Film in zwei Punkten sehr zu ähneln: Erstens ist das zwar alles nicht so doll, aber zweitens sei David Oyelowo („Interstellar“) eine Offenbarung und deshalb schaffe der Film es irgendwie, als Durchschnitt durchzugehen. Eine Einschätzung, der man mit Abzügen zustimmen kann. David Oyelowo ist tatsächlich eine Übermacht in diesem kurzen Kammerspiel (Handlungsort ist lediglich das kleine Haus, in dem der einzige Charakter Peter Snowden lebt) und tatsächlich ist das alles nicht so doll. Aber durchschnittlich zu sein, das gelingt dem Film ganz knapp nicht. Dabei gelingt es Oyelowo scheinbar mühelos, den Film weitestgehend zu tragen. Die größte Qualität seines Spiels liegt stets darin, dass er nicht nur jegliche Gefühlsregungen und Ausdrucksform schulisch korrekt beherrscht (von Gesangseinlagen zu absoluter Stille, von depressiver Einsamkeit zu überbordender Lebensfreude), sondern dass er vor allem stets den Ursprung seines Gefühlszustandes verschleiern kann. Der Zuschauer wird dadurch ebenso zum Opfer von Peters Verstand wie der Charakter selbst. Das ist Schauspiel seltenster Qualität.
Und damit hätte man auch schon den einzigen Pluspunkt des Films besprochen. Auf der anderen Seite warten leider deutlich mehr Kritikpunkte. So ist es bereits nach fünf Minuten deutlich, dass der Film keinerlei Preise für eine sonderlich einfallsreiche Inszenierung bekommen wird. Der gespaltene Gemütszustand Snowdens (dessen Nachname kein Zufall ist, er versucht stets, seinen Freund Edward anzurufen) wird durch Spiegel und Jump Cuts dargestellt - Hitchcock und Woody Allen haben das vor Jahrzehnten gemacht und ihren Figuren so und Handlungen eine ambivalente Aura der Gefahr und Orientierungslosigkeit verpasst. Snowden hingegen scheint mit jedem Blick in den Spiegel vor allem einen Gedanken in den Kopf des Zuschauers pflanzen zu wollen: „Mann, ist der Typ verrückt!“ Keine Zwischentöne, kein Garnichts, nur ein plattes Brett bekommt man hier vor den Latz geknallt. Dazu gesellt sich mit der Zeit eine unheimlich repetitive Art und Weise, sodass der Film sich bei nur 80 Minuten Laufzeit immer wieder brutal ausbremst und beweist, dass eine Beschränkung auf wenige Figuren und Orte nicht zwangsweise die Kreativität beflügelt.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org