Am 19. Juli verstarb der amerikanische Regisseur Garry Marshall im Alter von 81 Jahren - nur wenige Monate nach der Premiere seines letzten Films. Hinterlassen hat er nicht nur Pretty Woman, Runaway Bride und seine einzigartige Prägung der romantischen Komödie in den 90er Jahren, sondern wohl vor allem auch tränennasse Gesichter, gibt es doch kaum Darsteller, die nicht in den höchsten Tönen über Marshall und sein offenes, freundliches Wesen sprachen. Vielleicht halfen ebenjene Umgänglichkeit und die familiäre Atmosphäre am Set dabei, für die späteren, um Feiertage und Festlichkeiten heruminszenierte Ensemble-Stücke stets einen absoluten Star-Cast zu versammeln. An jene Filme - Valentine's Day und New Year's Eve - schließt Marshall mit seinem letzten Film Mother's Day an und beendet kurz vor seinem Ableben noch die inoffizielle "Holiday-Trilogie", wie sie vielerorts bereits genannt wird.
Mother's Day ist, wie der deutsche Zusatztitel noch mal verstärkt deutlich macht, Marshalls Liebeserklärung an alle Mütter dieser Welt. Der Film erzählt in parallel verlaufenden Handlungssträngen von zerrütteten Familienverhältnissen, mit einem konkreten Blick auf die Mutterrollen in ebendiesen. Wir folgen diesen Geschichten über eine Handvoll Tage hinweg, bis hin zum grand finale der komplizierten Beziehungen: dem Muttertag. Diesem erlegt Marshall gleich von der ersten Szene an eine Bedeutsamkeit auf, wie es weder Menschen auf, noch vor der Kinoleinwand je zuvor gemacht haben. In der kleinen amerikanischen Vorstadt, die mehr eine Aneinanderreihung von riesigen Luxusvillen ist (in denen die Figuren quasi Tür an Tür leben), ist der Muttertag Gesprächsthema Nummer 1. Es wird geplant, geplaudert und ein riesiger Uterus aus Stoff auf einem Auto befestigt. Warum das? Na, für den Muttertagsumzug natürlich!
Man könnte Mother's Day vorwerfen, ein schlechter Film zu sein. Man könnte seine Geschichte(n) langweilig nennen, seine Witze altbacken, seine Schauspieler hölzern und seine Weltanschauung reaktionär. All das sind gute, treffende Adjektive, die der Film sich verdient und Leser in der Sicherheit wiegen lassen, es handele sich nur um einen weiteren blöden Film in dieser ganz und gar blöden Kinosaison des Sommers. Aber angesichts von Mother's Day verblassen alle diese Wörter in einer fruchtlosen Belanglosigkeit; ihnen wird ihr Gehalt und ihre Bedeutung genommen; sie werden durch den bloßen Gebrauch für alle zukünftigen Verwendungen entwertet. Darum möchte ich das nicht tun. Mother's Day ist viel eher das, was man einen Ausnahmefilm nennen könnte, in jeder erdenklichen Hinsicht. Es ist die Art Film, die den Zuschauer für einen kurzen Moment fürchten lässt, er könne nie mehr zurückkehren in die großen, vertrauten Kinosäle, in denen Träume wahr werden sollen.
Die Welt, die der Film in seinen qualvollen zwei Stunden Laufzeit entwirft, entbehrt jeden Realitätsanspruchs. Die sonnige Hochglanz-Idylle könnte teurer und keimfreier nicht sein, genau wie die in ihr lebenden Figuren. Und die schicken sich an, jedes der sich bereits beim Poster anbietenden "white people"-Klischees zu erfüllen. Schöne, weiße und reiche Menschen und ihre furchtbaren, furchtbaren Probleme! Jennifer Anistons Ex-Mann hat seine viel jüngere Freundin mit großen Brüsten geheiratet! Haha! Jason Sudeikis muss für seine Tochter an der Supermarktkasse Tampons kaufen! Hihi! Sarah Chalkes Mutter hält die Partnerin ihrer Tochter wegen ihrer kurzen Haare erst für einen Mann! Hoho! Keine Konversation zwischen zwei Figuren fühlt sich nicht unnatürlich an, keiner der Witze ist nicht peinlich abgedroschen oder platt und keine Szene wirft nicht die Frage auf, warum wir uns für die Probleme dieser schönen, weißen und reichen Menschen überhaupt interessieren sollen.
Aber natürlich ist das am Ende alles egal, denn in Mother's Day geht es ja um die (Mutter-)Liebe und mit der geht schließlich die gegenseitige Akzeptanz einher. Am deutlichsten sagt der Film das durch die Eltern von Kate Hudsons Figur, die ihr bewaffnet mit Hähnchenkeulen, USA-Flaggen, Homophobie und Rassismus einen Überraschungsbesuch abstatten (womöglich auf der Durchreise, um der nächsten Rede von Donald Trump persönlich beizuwohnen). Die wollen es nicht glauben, dass eine ihrer Töchter eine Frau und die andere einen Inder geheiratet hat. Dieser Alltagsrassismus, diese Schwulenfeindlichkeit! Und dann nennt der Vater den indischen Ehemann auch noch einen "Kameltreiber" - zum Schreien! Dann kommt es aber zufällig zu einem Skype-Telefonat mit der indischen Schwiegermutter (das sich anfühlt wie eine Szene aus The Big Bang Theory), die natürlich mit einem total lustigen indischen Akzent spricht und die rassistischen Witze ihres Gegenübers nicht versteht. Deswegen sagt sie: "Diesen Witz verstehe ich nicht. Aber er klingt rassistisch. Und lustig!" und bricht in Gelächter aus.
Es ist nicht nur, dass der Film Rassismus, Homophobie und allgemeines Gespött über Minderheiten (ein Kleinwüchsiger namens Shorty - gibt es etwas Lustigeres?) durchgehend für peinliche Klischeewitze ausnutzt, am Ende möchte er sich auf sein scheinliberales Weltbild berufen und lässt die Charaktere in den unerträglich kitschigen Endminuten einander in die Arme fallen, nachdem er ihnen durch Todesangst Liebesschwüre abgerungen hat. Es ist ein abstoßendes, heuchlerisches Kino; dumm und verlogen bis in die letzte weiße Hautpore seiner Figuren und inszeniert mit so einer aufdringlichen Inkompetenz, dass man die Augen abwenden und sich weigern möchte, diesen widerlichen Wohlstandsmenschen weiterhin beim Bewältigen ihrer "first world problems" zuzusehen - wo doch ihr größtes Problem wahrscheinlich immer noch ist, dass sie nach dem Frühstück nicht im Garten Pilates machen können, weil die Haushaltskraft gerade den Rasen mäht.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org






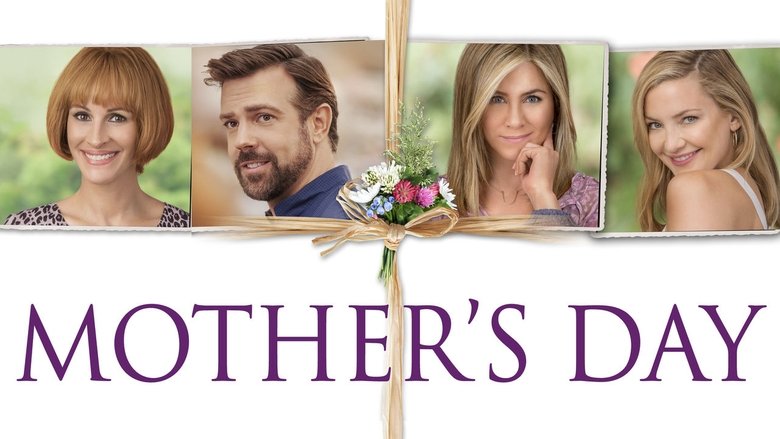


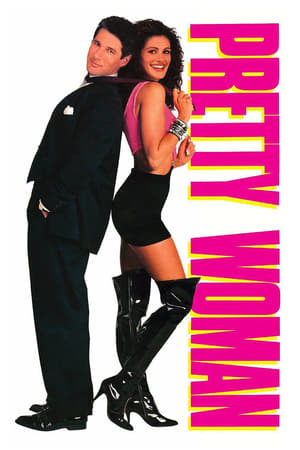



Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!