Erschreckend, wie viel im Leben doch letzten Endes vom Glück abhängig ist. Vor allem dann, wenn man sich erst einmal ins Bewusstsein ruft, wie wenig es eigentlich auf das reine Können ankommt. Kontrolle ist eine Illusion, die Fäden unseres Daseins werden an einer anderer, ja, durch und durch willkürlichen Stelle gezogen. Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers, From Paris With Love) wird im Verlauf der zweistündigen Laufzeit von Match Point mehrfach am eigenen Leibe erfahren, was es bedeutet, auf der Soll- und Habenseite des Zufalls zu stehen. Seine Karriere als Tennisprofi hat er aufgegeben, der Tour-Zirkus ist ihm irgendwann zuwider geworden. Stattdessen heuert er in einem Tennisclub der High Society an, präsentiert sich charmant, aufmerksam und formgewandt und schafft es, in den inneren Zirkel der stinkreichen Industriellenfamilie Hewett aufgenommen zu werden.
Seine Beziehung zu Chloe (Emily Mortimer, Shutter Island) gleicht einem kalkulierten Sicherheitsschachzug. Nicht nur verleiht diese ihm die goldene Eintrittskarte in die Londoner Upperclass, er kann sich dadurch auch einen Job in der Firma ihres Vaters (Brian Cox, Blutmond) sichern – und das ohne jede Ausbildung. Das einzige, was seinen heimtückischen Plan immer wieder ein Stück weit ins Wanken bringt, ist Nola (Scarlett Johansson, Under the Skin), die Freundin seines Schwagers in spe (Matthew Goode, Stoker). Beide sind sie nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und beiden ist schnell anzusehen, dass ihnen das distinguierte Theater im Dienste der britischen Elite eine unverkennbare Müdigkeit in die Gesichter treibt. Chris und Chloe heiraten, das macht man nun mal so, Nola hingegen ist alsbald wieder solo – dem lustvollen Verhältnis steht also nichts mehr im Weg. Bis auf, natürlich, dem Schicksal.
Nachdem man Woody Allen (Der Stadtneurotiker) nicht unberechtigt nachsagte, er würde sich nur noch mit Variationen seiner großen Klassiker beschäftigen und ausschließlich wuselige Endlosschleifen großstädtischer Irrungen und Wirrungen reproduzieren, kam Match Point 2005 in die Kinos. Ein Film, der sich nicht nur für den Zuschauer, sondern auch für das – tatsächlich – durchaus gemütlich gewordene Schaffen des Altmeisters wie ein Pflock im Herzen der (fraglos) hochklassigen Komfortzone anfühlte. Fernab der wärmenden Geneigtheit, die Allen seinen Charakteren immerzu entgegenbringen konnte und abgekapselt vom ironischen Rhetorikschwung, der ihm eine Oscar-Nominierung nach der nächsten einbrachte, ist Match Point eine giftige, hinterhältige und in seiner Unversöhnlichkeit wahnsinnig virtuose Übersetzung von Dostojewskis litearischem Meilenstein Schuld und Sühne. Chris gewöhnt sich alsbald an den Lebensstil des höheren Kreises – seine Erfolgsversessenheit redet ihm selbst die Möglichkeit eines gerechten Mordes ein.
Woody Allen legt einen rücksichtslosen Zynismus an den Tag, der seinen Anfang allein damit nimmt, einen Tennisball auf der Netzkante tanzen zu lassen. Bruchteile einer Sekunde entscheiden darüber, wer aufsteigt und wer fällt, wer gewinnt und wer verliert. Dieser Zustand der Ungewissheit, dieser Moment in der Schwebe, bevor sich der Ball entschließt, auf die rechte oder linke Seite zu fallen, beschreibt das Klima, in dem sich Match Point entfaltet, sehr exakt. Jeder Schritt könnte hier eine intrigante Lawine in Bewegung setzen, die sich weder mit Ehrgeiz, noch mit Leidenschaft ausbremsen lässt. Also, warum Gefahr laufen, das gute Leben am Ufer der Themse aufgeben zu müssen? Wenn dröge Gespräche über die Intensität von Pinselstrichen und der Beischlaf mit einer Frau, die nur Mittel zum Zweck ist, der Preis für niemals versiegenden Wohlstand sind, ist Chris gerne bereit, diesen zu zahlen.
Mit der Präzision eines Chirurgen, zielstrebig, konzentriert und unabdingbar, nistet Woody Allen seine Charaktere in diese eiskalte Welt aus Schein und Sein ein. Vordergründig zuvorkommend, liebreizend und kultiviert, muss früher oder später dann doch Blut fließen. Blut, das nötig erscheint, um sich selbst den ein oder anderen Stolperstein aus dem Weg räumen zu können. Und das Schlimmste daran: Bevor der Zuschauer merkt, mit was für einem Menschen er es hier eigentlich mit Chris zu tun bekommt, sind die Sympathien für das durchtrieben-habgierige Scheusal bereits verteilt. Man fiebert mit und man ekelt sich. Jonathan Rhys Meyers jedenfalls war indes nie besser als unter der Ägide von Woody Allen, sein steinernes Mienenspiel wird fortwährend durch das unbarmherzige Funkeln in seinen Augen torpediert. Was dieser Mann sieht, das möchte er haben – und das Schicksal ist ihm in seinem liderlichen Tun auch noch gewogen. Spiel, Satz und Sieg.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org










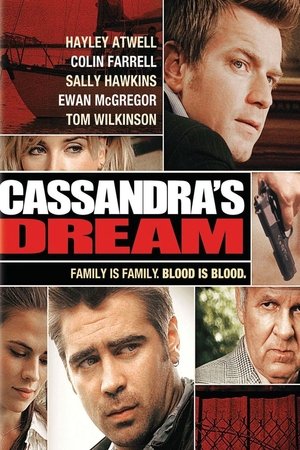


Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!