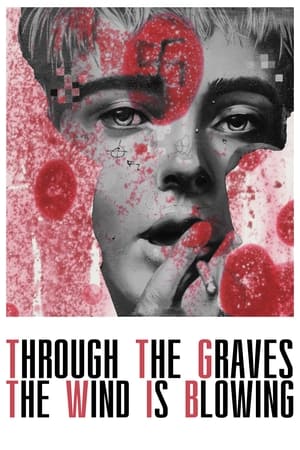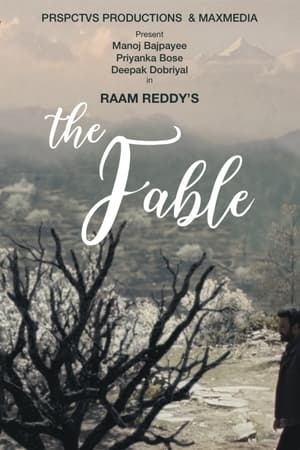Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org
Inhalt
×