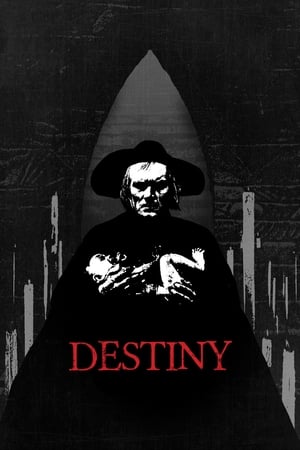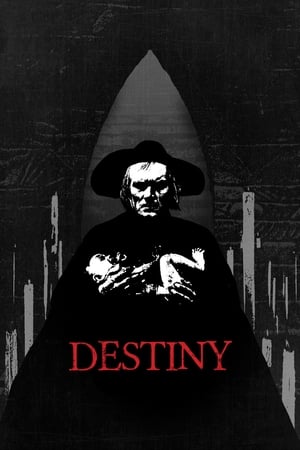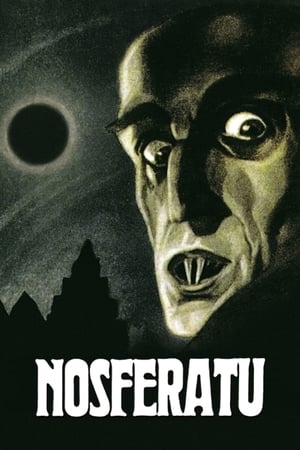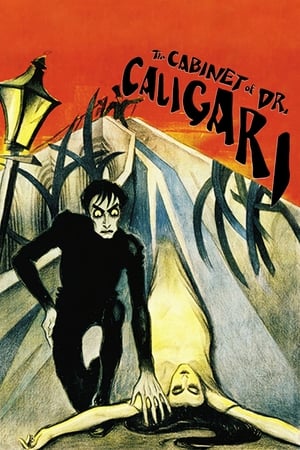„Glaub mir, mein Amt ist schwer! Es ist ein Fluch! Ich bin es müd, der Menschen Leid zu sehen und Hass zu ernten, weil ich Gott gehorche…“
Es ist fast ein kleines Wunder, dass „Der müde Tod“ von Fritz Lang („Metropolis“) in akribischer Arbeit eher rekonstruiert als restauriert werden konnte. Da keine vollständige Originalkopie mehr vorliegt, musst weltweit in Filmarchiven nach verwertbarem Material geforscht werden, um nun eine Version zu erstellen, die (wahrscheinlich) der ursprünglichen Fassung von Lang so nahe wie möglich kommt. Wie gut das gelungen ist, könnten wohl nur Zeitzeugen der Uraufführung noch bestätigen. Davon dürfte es nicht mehr allzu viele geben. In wie weit die jetzige Auflage von dem Original abweichen mag, ist an sich relativ irrelevant: Das was man zu sehen bekommt, ist nicht weniger als ein frühes Meisterwerk der Filmkunst, wegweisend wie prägend für das, was wir heute noch im Medium erleben.
„Ein deutsches Volkslied in sechs Versen“, so der Untertitel, erzählt von einer jungen Frau (Lil Dagover, „Der Richter und sein Henker“) und ihrem hoffnungslosen Kampf gegen das Schicksal. Der Tod - klassisch personifiziert als düstere, hagere Gestallt mit beeindruckender Präsenz von Bernhard Goetzke(„Die Nibelungen: Siegfried“) – holt überraschend ihren Liebsten zu sich, seine Zeit (plastisch dargestellt durch eine ihm kurz zuvor präsentierte Sanduhr) ist abgelaufen. Dies will die verzweifelte Frau nicht wahrhaben, wählt den Freitod, um dem Allmächtigen Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Sie fleht um eine Möglichkeit, das Unvermeidbare rückgängig zu machen. Ganz anders als sonst meistens der Fall, wird der Tod nicht als eine bösartige Macht vorgestellt, bald widersprüchlich zu seinem furchterregenden Äußeren. Er genießt seine Rolle nicht, im Gegenteil, er erfüllt sie nur (noch) pflichtbewusst. Als Teil eines natürlichen, wichtigen Bausteins der weltlichen und spirituellen Existenz. Heute würde man von einem bevorstehenden Burnout sprechen. Auch deshalb lässt er sich auf eine Abmachung ein, die er als nicht zu meistern bezeichnet, aber insgeheim scheinbar selbst darauf hofft, er möge sich irren.
Die trauernde Witwe bekommt die Chance in drei Persönlichkeiten zu verschiedenen Epochen und an anderen Schauplätzen zu schlüpfen, um das Schicksal zu ändern. Wenn es ihr gelingt, wird ihr Anliegen gewährt. Kann Liebe wirklich stärker als der Tod sein? Und wenn ja, welcher Preis ist dafür letztlich zu erbringen? Ein philosophischer Ansatz, der nicht wie eine bleierne Schwere über dem Film liegt, dennoch sein Dreh- und Angelpunkt ist. Unabhängig von der besonders im Finale rührenden wie ergreifenden Thematik gelingt Fritz Lang auf dem Weg dorthin eine phantastische Reise, wie sie Film im Idealfall heute noch sein sollte, aber – wenn wir ehrlich sind – nur noch selten ist. Zu sehr ist inzwischen alles standardisiert, lädt nicht mehr zum echten Staunen und Erleben ein. Eine Form von Abstumpfung hat sich breit gemacht, was nicht in erster Linie am Publikum liegt, nur wie lässt sich in Zeiten von technisch unbegrenzten Möglichkeiten, selbstverständlicher Dekadenz (im Verhältnis gesehen) und den immer gleichen Geschichten noch dieser Zauber reanimieren? Ein ähnliches Kunststück, eine ähnliche Meisterleistung wie sie Fritz Lang 1921 erbrachte. Was selbst heute noch beeindruckt und erst recht wenn man bedenkt, dass es sich hier um – nicht despektierlich, schlicht realistisch – bald prähistorisches Material handelt.
Mit welchen schlichten Ressourcen nicht nur eine metaphorische, tiefe Geschichte erzählt wird, sondern speziell wie unglaublich stilbildend und maßgeblich die späteren, cineastische Folgearbeit hier auf den Weg gebracht werden, dürfte jeden Filmfan in leichte Ekstase versetzen. Bei seiner Premiere nicht als reiner Schwarz-Weiß-Film vorgeführt, bereits mit stilistisch wichtiger, frühen Nachkolorierung arbeitend, wurde „Der müde Tod“ danach im klassischen Grau-in-Grau präsentiert, was bei der aktuellen Rekonstruierung wieder aufgegriffen wurde. Allein dieses vorausschauende Arbeiten mit den Möglichkeiten des Mediums gibt dem Film erheblich mehr Qualität. Tag-Nacht-Darstellungen, essentiell wichtig Stimmungswechsel sowie der nicht unerhebliche Anstieg des dramatischen Effekts im Finale gewinnen dadurch deutlich an Intensität, was bei einem Stummfilm – der von der Kraft seiner Bildsprache deutlicher zehren muss – ein revolutionärer Punkt ist. Dazu die generelle, visuelle Ästhetik eines Fritz Lang, auf dessen Einstellungsfetischismus, dem gezielten Einsatz von Lichtquellen und der Wirkung von Bildmontagen unzählige, bedeutenden Regisseure (ob freiwillig, unterbewusst oder dann doch nur zufällig) zurückzuführen sind.
Von Orson Welles („Citizen Kane“),Alfred Hitchcock („Rebecca“) oder John Huston („Die Spur des Falken“), bis hin zu Sergio Leone („Spiel mir das Lied vom Tod“), Dario Argento („Suspiria“) oder sogar – um die Moderne ganz gezielt ins Spiel zu bringen - Nicolas Winding Refn („Drive“). Sie alle bauen oder bauten auf dem auf, was Lang etablierte. Selbst wenn das ganze filmhistorische Hätte-wäre-wenn-Blabla ausgeklammert wird, der enorme Aufwand dieser Produktion ist aller Ehren wert. Spezialeffekte, die für ihren Entstehungszeitraum ans magische Grenzen, ein - entsprechend beurteilt – wahnwitziges Setdesign (besonders die China-Episode ist für damalige Verhältnisse nicht von dieser Welt) und ein Einsatz, der aktuell gar nicht mehr betrieben wird, da der Computer alles regelt. Lebendige, wilde Tiere wie Elefanten und Tiger in einer Szene mit den Darstellern, absolut undenkbar in den „besseren“ CGI-Zeiten. Technisch ist „Der müde Tod“ nicht weniger als das Maß der Dinge für seinen Jahrgang und es gelingt ihm immer noch, dieses Gefühl zu transportieren.
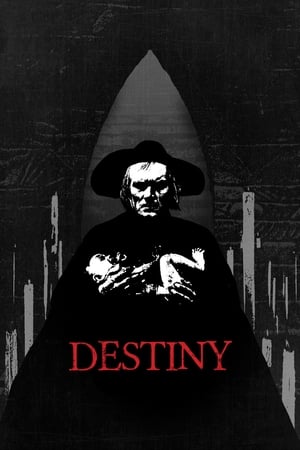 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org