Das Horror-Genre ist deshalb so interessant, weil es so viel über unsere menschliche Psyche aussagt. Schaut man sich Nightmare on Elm Street an, so ist der Klassiker von Wes Craven (Scream)als einziger Alptraum zu verstehen, während sich Halloween mit der Angst vor dem Fremden beschäftig und die Saw- Reihe den inneren moralischen Monolog zum Thema hat. Besonders gelungen sind Horrorfilme dann, wenn sie aus der psychischen Grundlage eine Welt erschaffen, die möglichst genau den Ängsten entspricht, die universell vorhanden sind. Besonders eignen tun sich dort Dunkelheit, Einsamkeit oder das „Fremde“, weswegen man diese Motive in den meisten Genre-Vertretern wiederfindet. Die Visualität für subjektiv empfundene Angst erhebt diese dabei auf ein neues Level, begrenzt sie durch die Fiktion jedoch auf das Filmerlebnis. Als Zuschauer wird man sozusagen auf einen Horror-Trip mitgenommen, der aus den bestehenden Ängsten das Schlimmstmögliche herausarbeitet, dieses Schlimmstmögliche jedoch temporär limitiert.
Dabei muss ein Horrorfilm nicht einmal unbedingt gruselig in dem Sinne sein, dass man den Kinobesuch kaum aushält, weil einem in jedem Moment ein Jumpscare in die Ohren dröhnt. Viele gute Horrorfilme verstehen es, den Film nicht nur als Erlebnis gruselig zu gestalten, sondern vor allem intellektuell. Get Out war da im vergangenen Jahr so ein Paradebeispiel, das wunderbar die politisch korrekte - wenn auch nicht weniger perfide - perfekte Glätte des linksliberalen Gesellschaftstrends darstellte. Horrorfilme funktionieren also nicht nur auf intuitiver, sondern oftmals auch auf ideologischer Ebene. Nach zahlreichen „Dämon- macht- im Haus- Krach- Filmen“ kam mit Der Babadook vor kurzem ein Film, der die Psyche auf sehr direkte Art und Weise einbindet. Das ist in dem Sinne sehr interessant, dass die Psyche zwar im Horror-Genre Dauergast ist, jedoch zumeist nicht zum direkten Gegenstand des Plots wird.
Ghostland fügt sich nun wunderbar in diesen wiedergefundenen Trend mit ein. Der Film zeigt uns die Aufarbeitung zweier Schwestern, die mit ihrer Mutter gemeinsam von zwei scheinbar Verrückten überfallen wurden. Die Psyche wird dabei in gewisser Form durch das Haus symbolisiert, das mit seinen vielen Türen und teils lokal unübersichtlichen Kamerafahrten wie ein Irrgarten wirkt, ein Irrgarten aus dem es kein Entrinnen gibt. Mit dieser bedrückenden Orientierungslosigkeit arbeitet Regisseur Pascal Laugier (Martyrs) ständig. Wir sehen nie was sich hinter der nächsten Tür verbirgt, haben sie mittlerweile auch schon wieder vergessen und können sie nicht mehr recht verorten. Ebenfalls interessant ist in diesem Zusammenhang die kontrastreiche Ästhetik, die auf der einen Seite mit Motiven wie Kindheit, Puppen und Erfolg etwas Harmonisches, auf der anderen Seite mit sexuellem Missbrauch und gewalttätiger Härte etwas Erschreckendes an sich hat. Perfide wird es vor allem dann, wenn Laugier beides in einander übergehen lässt.
Sehr gelungen an Ghostland sind darüber hinaus die intelligent eingesetzten Referenzen. Hier wird nicht wild auf irgendwelche Filme hingewiesen, um ein Schmunzeln bei dem einen oder anderen Nerd zu erlangen, sondern hier werden bewusst und limitiert Anspielungen eingebaut, die den ganzen Film begleiten. Zum Beispiel eine Bemerkung im ersten Drittel, dass das Haus der Familie an ein Haus aus einem Rob Zombie- Film erinnere, was natürlich eine eindeutige Anspielung an sein Meisterwerk Haus der 1000 Leichen ist. Und tatsächlich finden wir in diesem Film eine ganze Menge von Zombies Terror-Kino, das sich schon immer durch die ästhetische Extremität und Befremdlichkeit der Antagonisten ausgezeichnet hat. Auch hier wirken die Antagonisten so befremdlich, dass sie gar nicht mehr wie Menschen, sondern wie Bestien wirken. Wie Zombie auch entfremdet der Film Alltagssituationen und Gegenstände so, dass sie in einem neuen viel düsteren Kontext erscheinen: ein Witz wird plötzlich böse und die Unschuld der Puppen wird gebrochen.
Auch der „Schrei“ spielt in Ghostland eine sehr zentrale Rolle, wenn auch in einem etwas abgewandelten Sinne. Wir kennen es: Ein Charakter versteckt sich und versucht still zu sein, um dem Antagonisten zu entgehen. Taucht der Antagonist auf, beginnt der Charakter zu schreien, weil er eh nichts mehr zu verbergen hat. In diesem Film ist das interessanterweise anders, denn hier wird das Schweigen zur täuschenden Waffe. Das Unterdrücken der eigenen Emotionen, der eigenen Menschlichkeit, kann also vor Gewalt schützen. Auch hier findet man wieder das Motiv der Entfremdung, das sich die Protagonisten aneignen müssen, um in der entfremdeten Terror-Welt zu überleben. Die Erklärungen für die Gräueltaten bleiben dabei aus. Es geht also nicht um Intentionen, um die Geschichte dahinter, sondern nur um den puren Terror in dem Moment.
Der Film fühlt sich bei all diesen intelligenten Gedanken an wie eine Reise, in der man nicht weiß wohin es geht. Bewusst führt er uns Klischees verschiedener Subgenres auf, lässt uns glauben wir befänden uns in einem übernatürlichen Film oder einem Home Invasion Thriller, stellt uns immer wieder die Frage, was nun Wirklichkeit ist, so dass wir uns bis zum Ende nur einer Sache wirklich sicher sein können: Der Existenz der Protagonistin. Descartes schriebden oft zitierten Satz „Ich denke, also bin ich“. Und tatsächlich leuchtet dieser simple wie geniale Satz auch in diesem Film ein. Das „Ghostland“ ist eine Ruine der menschlichen Psyche, die durch Terror so beschädigt worden ist, dass der Zuschauer sich stets fragen muss, was er nun glauben kann und was nicht. Nur durch die Existenz der Psyche, die dauerhaft evident bleibt, begreifen wir, dass die Protagonistin zwingend existieren muss und bildet damit unseren einzigen Leidfaden in diesem Irrgarten.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org





























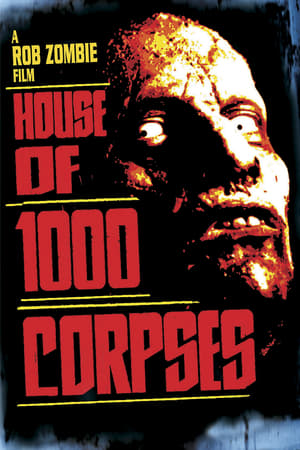
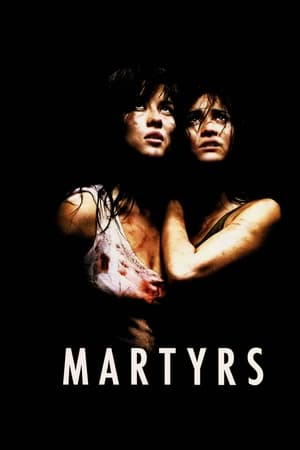


Kommentare (0)
Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.
Melde dich an oder registriere dich bei uns!