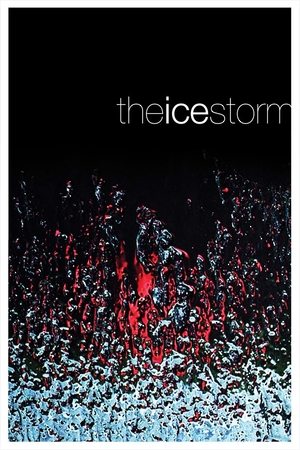Wenn es nach dem Kino geht, erfüllt niemand die Rolle eines Helden so gut, wie der Mann. Hundertausende Filme sowie Geschichten haben das Geschlecht Mann zum ultimativen Heldentypus geformt: entschlossen, kraftvoll und tapfer. So muss es sein, denn so war es ja schon immer. Der schwedische Regisseur Ruben Östlund nimmt nun dieses Rollenbild und demontiert es. Er ist nicht der erste, der dies tut. Sogar der Meister des maskulinen Heldentums, Michael Bay, hatte schon einmal die Chuzpe gehabt, um das Heroenbild komödiantisch zu massakrieren und der Lächerlichkeit Preis zu geben, welches er sonst in seinen Actionfilmen seit Jahren ohne mit der Wimper zu zucken verwendet. „Pain & Gain“ hieß dieser herrliche Film. Mit ihm kann man „Höhere Gewalt“ aber gewiss nur in geringfügigen Aspekten vergleichen. Östlund vertraut, anders als Bay, auf die Kraft der Subtilität und der Nuancen. Das Ergebnis ist eine herrlich ruhige Zerlegung eines uralten Mythos, die so leise wie bissig geraten ist.
„Höhere Gewalt“ geht die Helden-Demontage analytisch an. Aufgeteilt in 5 Kapiteln, jeder Urlaubstag der Familie gleicht einem Kapitel, folgt Östlund der schwedischen Familie, die in einem Skigebiet eigentlich ihren Urlaub genießen will. Doch nachdem Vater Tomas (Johannes Kuhnke) vor einer Lawine flieht, ohne dabei seiner Frau Ebba (Lisa Loven Kongsli) und den beiden Kindern Harry und Vera zu helfen, hängt der Haussegen schief. Die Kinder fühlen sich im Stich gelassen und Frau Ebba schluckt ihre Wut und ihre Trauer erst einmal hinunter, versucht sie später aber zu kanalisieren, was darin gipfelt, dass sie ihren Mann mit dem Ereignis konfrontiert, ihn regelrecht bloß stellt und oftmals fast schon schmerzvoll einzig und alleine auf diese eine Versagen reduziert. Das alles kommt größtenteils ohne Geschreie, ohne Gezeter aus. Östlund zeigt in brillant choreographierten Bildern, wie der Lawinenvorfall die Familie in eine Art emotionale Ohnmacht verfrachtet. Ob Tomas wirklich ein Feigling ist oder seine Flucht eine Impulshandlung war, darauf geht Östlund nicht näher ein. Ihn interessieren die Folgen davon. Liegt die Familie zu Beginn noch friedvoll zusammen im Bett, wirken ihre Interaktion nach dem Vorfall fast schon monströs voneinander abgekapselt. „Höhere Gewalt“ behandelt nicht nur die Frage nach einem männlichen Heldenbild, sondern erforscht auch die Mechaniken familiäre Idyllen.
Regisseur Östlund versteht sich dabei als stiller Skeptiker der immer wieder die Wunde untersucht, ohne darin tiefenverbittert weiter herum zu stochern. Es scheint fast so, als ob Östlund mit der Lawine letztlich nur einen Anstoß gab. Alles andere was danach geschieht gleich einem Fluss, einem klaren, physikalischen Gesetz: Die Dingen gehen ihren Weg. Im Falle von „Höhere Gewalt“ endet dies im Pragmatismus. Gattin Ebba übernimmt kurzerhand die Rolle, die im gesellschaftlichen Kanon eigentlich ihr Mann zu erfüllen hätte. Das macht Ruben Östlund mit einer wirklich grandiosen, letzten Szene deutlich und unterstreicht dazu seine Qualitäten als beobachtender Regisseur, der es versteht keine festen, einseitigen Argumente zu zulassen. Der Zuschauer muss hier selbst tätig werden, die Momente zwischen der Familie selbstständig begreifen, abtasten und verstehen. Dann eröffnen sich auch diverse äußerst schwarzhumorige Attribute, denn hinter seiner ehe emotionalen Gewichtung, versteckt sich ein durch und durch teuflischer Kern.
Alleine wenn Ebba das befreundete Paar Mats (Kristofer Hivju) und Fanni (Fanni Metelius) in die Krise miteinbezieht, zeigt sich Östlands Hang zur prüfenden Bosheit. Denn die Vertrauensfrage zwischen Gatte und Gattin und gleichzeitig deren Rollenmodell, wird demgemäß weitergetragen und gedeiht so auch bei Mats und Fanny zu einem drohenden Schatten innerhalb ihrer (recht frischen) Beziehung. Es gleicht fast schon einem Virus oder Parasiten, der eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Hier zeigt sich auch, dass „Höhere Gewalt“, ähnlich wie David Finchers „Gone Girl – Das perfekte Opfer“, eine resistente Beziehungssatire ist. Statt Hollywood-Chic gibt es hier klare, aufgeräumte aber stetig faszinierende, ja doppeldeutige Bilder, die zusammen mit dem Geschehen eine fast schon universelle Einheit bilden. Zusammen ergibt das ein grandioses Sehvergnügen, über welches man auch als kinderloser Single gewiss herrlich nachgrübeln kann, denn die Frage nachdem eigenen Heldentum ist näher als man denkt.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org