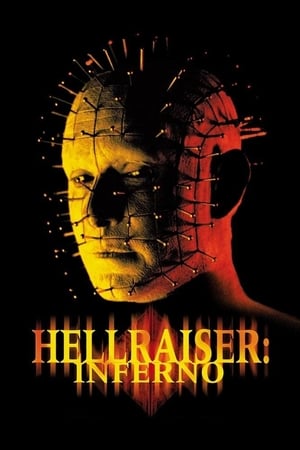Obacht, ein Alan Smithee-Film. Warum ist das mit Vorsicht zu genießen? Wer es noch nicht weiß: Alan Smithee ist der absichtliche John Doe von Hollywood. Ein Platzhalter. Ein Synonym für Scham oder Protest gegenüber dem abgelieferten Produkt, an dem man entscheidend beteiligt war. Dieses Pseudonym findet immer dann Verwendung, wenn ein Regisseur seinen Namen nicht (mehr) für den fertigen Film hergeben will. Also per se kein gutes Zeichen, obgleich dies natürlich verschiedene Gründe haben kann. Im Idealfall ist es schlicht aus künstlerischen Diskrepanzen zu diesem Schritt gekommen, was auch in diesem Fall vorgegeben wird.
Für den Make-Up-Artist Kevin Yagher sollte es nach zwei Regiearbeiten für Geschichten aus der Gruft eigentlich sein Spielfilmdebüt werden, am Ende warf er frustriert das Handtuch und versuchte sich nie wieder in dieser Position. Wohl ständig übervorteilt in jedweder Entscheidungsfindung – was unter anderem zu einer völlig differenten Schnittfassung als ursprünglich geplant führte -, verließ er das Projekt. Den Film vollenden durfte Kollege Joe Chappelle, zu dessen wichtigsten Arbeiten die zurecht völlig in Vergessenheit geratene Dean Koontz-Adaptions-Gurke Phantoms und – jetzt kommt es – das direkt zuvor veröffentlichte Desaster und Franchise-Grabgesteck Halloween 6 – Der Fluch des Michael Myers zählen. Also mit das Schlimmste, was dem eh stiefmütterlich behandelten Horrorfilm der 90er Jahre so untergekommen ist. Na Prost Mahlzeit, das kann ja was werden. Als wäre das noch nicht entmutigend genug, wird dem dritten Sequel zu Clive Barker’s zunächst niedergeschriebenen und im Anschluss in Form seines Regiedebüts auch noch selbst adaptierten Genre-Klassikers Hellraiser – Das Tor zur Hölle auch noch die absolute Kapitulation eines jeden Horror-Franchise dargeboten: Lost in Space, da einem sonst nichts mehr einfällt.
Wann immer eine Horrorfilmreihe urplötzlich in ein Sci-Fi-Weltall-Szenario geschubst werden musste, ist das quasi deren Bankrotterklärung. Die eh schon bescheuerten Witzfigur Leprechaun erging es praktisch zeitgleich mit Leprechaun 4: In Space ähnlich und später musste sich selbst Jason Vorhees ausgerechnet zum zehnten Jubiläum in Jason X durch eine Raumstation slashern, dabei allerdings noch mit einem akzeptablen Nonsense-Faktor, Selbstironie und einem Cameo von David Cronenberg (Die Fliege). Dazu muss gesagt werden, dass diese Serie ursprünglich hiermit auch beendet werden sollte. Daher könnte dies einen so radikalen (aber immer noch dämlichen) Schritt wenigstens erklären – das bis heute noch vier weitere Teile folgten macht diesen Unfug nun wirklich nicht besser. Aber nun zum wirklichen Gag bei der Sache: Ausgerechnet der Part auf der Raumstation ist das Beste am Film…denn er spielt da nicht exklusiv. Eigentlich nur grob ein Drittel des Plots, aufgeteilt auf Epilog und Finale. Der Rest wird zur Zeitreise, angefangen mit der Erschaffung des mysteriösen Würfels und Höllen-Dosenöffners. Also Antworten auf Fragen, die keiner wissen will und dem Mythos nur schaden anstatt nützen können.
Hauptdarsteller Bruce Ramsay (Liberace - Zuviel des Guten ist wundervoll) schlüpft über knapp 500 Jahre in drei verschiedenen Rollen der gleichen Blutlinie. Die des Spielzeugmachers Merchant, der einst den Zauberwürfel entwarf. Es seitdem nicht nur als Bürde und Familienfluch mit sich herumschleppt, sondern stets von den „Eindringlingen“ aus dem Höllenschlund deswegen gejagt wird. Mal ganz unabhängig von den ganzen anderen Unzulänglichkeiten: Was soll das denn? Der Film basiert auf der Idee, dass irgendwann im 22. Jahrhundert der x-te Nachfahre immer noch den Kampf gegen die Zenobiten führt, obwohl diese das ganze Problem schon hunderte Jahre zu den Akten hätten legen können. Sie töten immer den aktuellen Hausherren, lassen aber stets die bereits vorhandenen Nachfolger in Ruhe. Nach gut 500 Jahren könnte man eventuell mal auf den Geistesblitz kommen, gleich die gesamte Sippschaft zu vernichten, dann hat man mal Ruhe. Ne, das geht irgendwie nicht und sowieso muss man ernsthaft hinterfragen, was die Ausgeburten der Hölle denn in der gesamten Zeit so getrieben haben. Seit siebzehnhundert Schlagmichtot schon ganz physisch auf Erden, ihre Anwesenheit hat aber offenbar keine flächendeckende Auswirkung. Wenn das die Apokalypse ist, hat sie sehr viel Geduld. Oder ist einfach stinkendfaul. Wirkt in den ersten Hellraiser-Filmen noch ganz anders, aber damit lässt sich das alles eh nicht mehr ernsthaft vergleichen.
„Das ist kein Raum, es ist ein Holocaust…“
Richtig skurril wird der eh schon sehr schäbig inszenierte Hellraiser IV: Bloodline ausgerechnet erst mit dem Auftauchen von seiner einst ikonischen Galionsfigur Pinhead (Doug Bradley, Cabal – Die Brut der Nacht). Das hatte mal bewusst gewählten Highlight-Charakter, hier killt es eine eh schon mühselig-ranzige Produktion (die sogar noch einen echten Kinostart hatte, kaum zu glauben), indem er sein bizarres Schreckgespenst zur bräsigsten Interpretation eines James Bond-Bösewichts degradiert. Das ist nicht mehr ein Repräsentant der Hölle, nur noch wie der angetrunkene Onkel auf einer Familienfeier, der sich in die unpassendsten Momenten zu Wort meldet und nach dessen seltsamen, bedeutungsschwangeren Gebrummel alle nur peinlich berührt einen Punkt am Boden zum Wegstarren suchen. Die fleischgewordene Pinnwand voll albernen Onelinern, würdelos zum Fraß vorgeworfen. Dazu passt leider die lieblose Inszenierung, die zwar dunkel, aber nie düster ist. Dunkel eher im negativen Kontext, sieht hier doch alles betont karg und spartanisch aus. Atmosphärisch ist hier gar nichts, was speziell die ersten beiden Teile so ungemein verstörend machte. Von deren Grundspannung Lichtjahre entfernt besitzt Hellraiser IV: Bloodline nur eine Qualität: Die drastischen, meist handgemachten Effekte sind teilweise echt fesch. Blut, Ungeziefer, Gekröse und Body-Horror, alles dabei, mitunter recht ansehnlich. Alles andere ist leider Käse mit Hang zur Selbstdemontage.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org